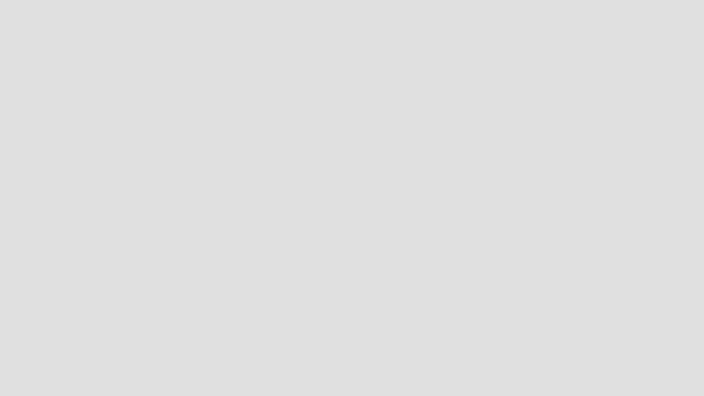Joseph Stiglitz hat die Idee sofort für sehr gefährlich gehalten. Es war im Dezember 2010. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve hatte angekündigt, noch mehr US-Dollar in das Finanzsystem zu pumpen. Der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger warnte: "Das Geld der Notenbank fließt nicht in die amerikanische Wirtschaft. Es landet in den Schwellenländern, die es nicht brauchen", sagte Stiglitz damals in der chilenischen Hauptstadt Santiago. "Diese Kapitalströme führen dazu, dass die dortigen Währungen stärker werden und eine Preisblase entsteht."
Und genau so kam es. Investoren tauschten ihre Dollar in Peso oder Rupiah, kauften in Argentinien, Mexiko, Indien, Türkei und Russland viele Aktien und Anleihen. Die Währungen gewannen an Wert, die Aktienmärkte auch. Anleger machten in den letzten Jahren sehr viel Profit in den Schwellenländern.
Doch nun haben die Geldprofis zum Rückzug geblasen. Die Heimholung des Kapitals beginnt. In den letzten vier Wochen sind fast vier Milliarden Dollar aus diesen Staaten abgeflossen. Die Währungen der Schwellenländer kollabierten, der russische Rubel, der südafrikanische Rand, der brasilianische Real und der mexikanische Peso sind so wenig wert wie lange nicht. Die Blase, von der Stiglitz sprach, ist in Gefahr zu platzen.
"Kein globales Risiko"
Die Turbulenzen an den Devisenmärkten schüren die Angst vor einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Mancher erinnert sich an die Asienkrise 1997. Die begann ähnlich, damals wertete der thailändische Baht massiv ab. In der Folge kam es in anderen asiatischen Staaten zu Verwerfungen, auch in Europa und Amerika waren die Beben spürbar. Droht nun Ähnliches?
Angesichts der heutzutage viel engeren Vernetzung der internationalen Finanzmärkte ist eine globale Ansteckung grundsätzlich immer möglich. Derzeit gilt dieses Szenario allerdings als unwahrscheinlich. Zudem sind die meisten Schwellenländer heute stabiler - verglichen mit 1997. In den Tresoren liegen höhere Devisenreserven. Außerdem haben die Akteure mehr Erfahrung im Umgang mit Krisen.
"Die Turbulenzen in den Schwellenländern stellen kein globales Risiko dar", sagt Folker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank. "Die betroffenen Staaten machen nur zehn Prozent der globalen Wirtschaft aus. Im Rest der Welt, vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch in der Euro-Zone geht es wirtschaftlich aufwärts. Davon werden auch die Schwellenländer profitieren." Deutsche Unternehmen spüren von Turbulenzen an den Devisenmärkten bislang noch nichts, dennoch sprechen die Konjunkturforscher des Ifo-Instituts "mittelfristig" von einer Gefahr für die Auftragslage der Konzerne.
Hausgemachte Probleme
Für die meisten Experten sind die Probleme in den Schwellenländern hausgemacht. Einige Staaten haben ein zu hohes Leistungsbilanzdefizit, das bedeutet, sie importieren mehr, als sie exportieren. Andere Länder müssen sich mit einer verfehlten Wirtschaftspolitik oder Korruption abfinden. "Die Gruppe der Schwellenländer ist nicht homogen", sagt Hellmeyer. "Indien leidet unter Korruption, schwindender Wachstumsdynamik und mangelhafter Infrastruktur. Und in Brasilien machen neben der Korruption die Überkapazitäten im Rohstoffbereich Sorge." Insgesamt, so der Experte, würden sich diese Staaten dadurch angreifbar machen.
Es ist noch nicht lange her, da waren den Investoren die Probleme vor Ort reichlich egal. Für sie zählte nur die Rendite. Der Fokus auf das Ausland musste sein, denn in der Heimat gab es zu wenig Zins, auch den Aktienmärkten traute 2010 und 2011 kaum ein Anleger über den Weg.
Doch nun hat sich der Wind gedreht. Wieder ist die amerikanische Notenbank der Hauptakteur, denn sie hat ihren geldpolitischen Kurs geändert. Die Fed drosselt die Geldzufuhr. Es werden künftig pro Monat nur noch 65 Milliarden Dollar ins Finanzsystem gepumpt - vor einem Monat waren es noch 85 Milliarden Dollar.
Das mag wie eine Petitesse wirken, doch Anleger haben sofort reagiert. Sie wissen, dass die Fed das Ende des billigen Geldes eingeläutet hat. Investitionen in Schwellenländern werden dadurch riskanter. Die Geldmanager stecken das Kapital nun lieber in amerikanische Staatsanleihen, die nun höhere Zinsen abwerfen, oder in US-Aktien, die auch einen Lauf haben.
In den Schwellenländern erhöhen Notenbanken deshalb den Leitzins - etwa in der Türkei. Das soll die Nachfrage und damit den Wechselkurs der eigenen Währung stärken. Langfristig müssen diese Länder aber ihre Wirtschaft reformieren. Die Wachstumsraten in Schwellenländern gehen zurück, von zuletzt durchschnittlich acht Prozent auf knapp fünf Prozent.
Investoren ist das zu wenig. Sie suchen den Profit nun woanders.