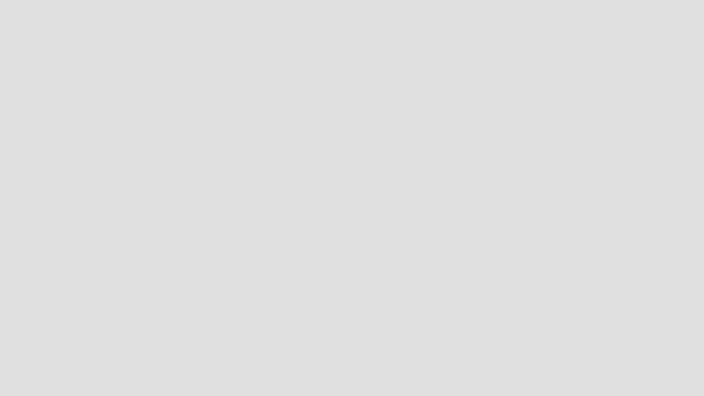Die europäischen Unterhändler für das angestrebte Freihandelsabkommen mit den USA erwarten bis September eine Entscheidung darüber, ob das Abkommen überhaupt eine Chance hat, unterzeichnet zu werden. Ob sich der Daumen über dem transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) hebe oder senke, hänge davon ab, ob die 28 nationalen Regierungen bereit seien, das fertig verhandelte Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) zu akzeptieren, hieß es am Freitag in der Führung der Europäischen Kommission. "Der Freihandelsvertrag mit Kanada ist ein Test für das Abkommen mit den USA", sagte ein hoher Kommissionsbeamter in Brüssel. Werde das Abkommen mit Kanada abgelehnt, "dann ist auch das mit den USA tot".
Deutsche EU-Diplomaten bestätigten am Freitag in Brüssel, dass die Bundesregierung das Abkommen mit Kanada "so, wie es jetzt verhandelt ist", nicht unterzeichnen könne. Deutschland sei zwar grundsätzlich bereit, das Abkommen im September zu paraphieren, allerdings sei das Kapitel zum rechtlichen Schutz von Investoren "problematisch" und derzeit nicht zu akzeptieren.
Konkret dreht sich der Streit um die Klauseln zum Schutz von Investoren. In einigen Mitgliedstaaten tobt ein heftiger Streit darüber, welche Rechtssicherheit Unternehmen erhalten sollen, die in den jeweils anderen Ländern investieren. Während der Investorenschutz im Freihandelsvertrag mit Kanada bisher weitgehend akzeptiert wurde, stießen die gleichen Klauseln im Abkommen mit den USA auf komplette Ablehnung. Es dürfe nicht sein, dass amerikanische Investoren künftig die Europäische Union oder einzelne Länder vor private Schiedsgerichte ziehen könnten, monieren die Kritiker. Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betonte, dass er die Idee, amerikanischen Investoren durch den Vertrag besonderen Rechtsschutz zu gewähren, für überflüssig halte. Dass die EU-Kommission von den Mitgliedstaaten beauftragt ist, genau diese Klauseln auszuhandeln und dass diese auch im Vertrag mit Kanada stehen sollen, blieb unerwähnt.
Korruption und lange Gerichtsprozesse
Inzwischen ist der Vertrag mit Kanada fertig ausgehandelt. Anfang kommender Woche werden die 28 Mitgliedstaaten den Vertrag offiziell zur Prüfung erhalten; einigen Hauptstädten, darunter Berlin, liegt er informell vor. Der Vertrag mit Kanada enthält - wie im Verhandlungsmandat vorgesehen, das alle 28 Länder einstimmig beschlossen haben - auch die Klauseln zum Investorenschutz.
Ohne diese Klauseln, heißt es in der Handelsabteilung der EU-Kommission, werde kaum ein kanadisches Unternehmen in Europa investieren. Wie solle ein Investment in Bulgarien, einem Land, dem die Europäische Kommission sozusagen amtlich zu hohe Korruption bescheinigt, ohne rechtlichen Schutz begründet werden? Oder in Italien, wo Prozesse vor nationalen Gerichten gern mal acht bis zehn Jahre dauern?
Die europäischen Unterhändler halten die meisten der Vorwürfe für ideologisch begründet aber sachlich nicht gerechtfertigt. Man habe angesichts der Kritik bereits durchgesetzt, dass europäische Regierungen mehr Handlungsspielraum erhielten und nicht einfach vor Gericht gezerrt werden könnten. "Das ist jetzt ein Kulturkampf", sagte ein hoher Kommissionsbeamter. Ließen die Hauptstädte wegen des Streits über den Investorenschutz den kanadischen Vertrag durchfallen, hieß es weiter, seien alle Verhandlungen so gut wie umsonst gewesen. Entweder verabschiede sich die EU dann ganz von der Idee der Freihandelsverträge, oder aber die 28 Mitgliedstaaten einigten sich darauf, der Kommission ganz neue Verhandlungsmandate zu erteilen.
Die Verhandlungen über eine Freihandelszone mit den USA, die auf andere Länder ausgedehnt werden soll, laufen seit 2013. Der Vertrag soll 2015 unterzeichnet werden. Verbraucherschützer lehnen ihn allerdings mehrheitlich ab, sie befürchten, er könne zu niedrigeren europäischen Standards führen.