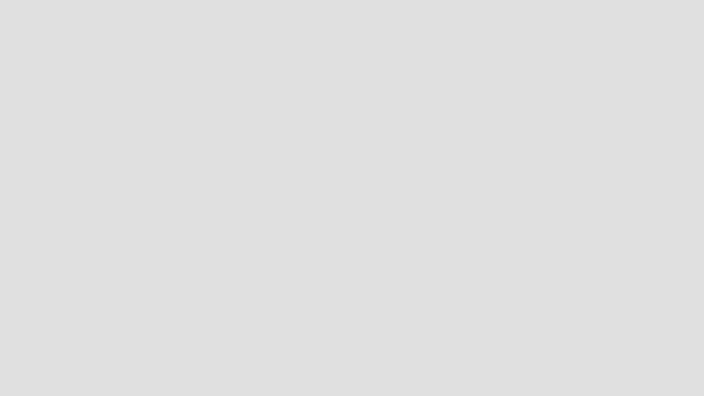Nach etwas mehr als einer Viertelstunde versucht Jeff Johnson noch einmal, seinen Gast zu überraschen. Der Journalist des TV-Senders BET, der sich vor allem an Afroamerikaner richtet, will von Barack Obama wissen, was sich dieser für die Kinder seiner beiden Töchter wünsche. "Nicht als Präsident, sondern als Mensch: Wie soll es Ihren Enkeln gehen?"
Obamas Antwort ist wohl formuliert. Er hoffe, dass seine Enkel als Individuen beurteilt würden - aufgrund ihres Charakters, ihrer Talente und Eigenschaften und nicht wegen ihrer Hautfarbe. Im ersten TV-Interview nach den umstrittenen Jury-Entscheidungen in den Todesfällen von Michael Brown in Ferguson und Eric Garner in New York spricht Amerikas erster schwarzer Präsident Klartext: Es dürfe nicht sein, dass jemand nur wegen seiner Hautfarbe strenger behandelt werde.
In Richtung des schwarzen Moderators Johnson sagt Obama: "Alle jungen Männer stellen dumme Sachen an, egal ob sie Latinos, Schwarze oder Weiße sind. Ich habe Fehler gemacht, Sie auch." Es müssten aber alle die Chance bekommen, sich zu entwickeln - und hier hätten es Afroamerikaner schwerer. Er wünsche sich, dass nicht nur der "perfekte junge Mann" gleich gut behandelt werde, sondern alle.
Alles, was Obama in diesen Sätzen sagt, stimmt: Das Risiko eines jungen schwarzen Amerikaners, von der Polizei erschossen zu werden, ist 21 Mal größer als das eines gleichaltrigen Weißen. Doch dieses Interview (hier in voller Länge) zeigt in aller Deutlichkeit, in welchem Zwiespalt sich Obama befindet - und weshalb so viele Schwarze von ihm enttäuscht sind. Es fehlt die Leidenschaft, das Spontane bei seinen Auftritten nach den Ferguson-Protesten. Es mangelt an jener echten Betroffenheit, die er etwa im Juli 2012 offenbarte, als er nach dem Tod des 17-jährigen Trayvon Martin sagte: "Vor 35 Jahren hätte ich Trayvon Martin sein können" (hier mehr über seine bemerkenswerte Rede).
Obama gibt der Wut und dem Schmerz der Schwarzen keine Stimme
Von diesen Emotionen ist heute wenig zu spüren, weil es Obama wichtiger zu sein scheint, das Amt des Präsidenten aller Amerikaner auszufüllen, als den Schmerz und die Wut der Schwarzen anzuerkennen, indem er diese auch zeigt. "Wie sich Obama über Rasse äußert, hängt immer davon ab, welches Amt er gerade innehat", konstatierte Ta-Nehisi Coates auf der Website des Magazins The Atlantic.
Im März 2008 war er noch Präsidentschaftskandidat und Hoffnungsträger der Schwarzen, als er in Philadelphia in aller Klarheit über Rassismus sprach, um sich von seinem Pfarrer Jeremiah Wright zu distanzieren. Ta-Nehisi Coates, einen der klügsten schwarzen Journalisten, macht Obamas Verhalten nicht wütend - es enttäuscht ihn vielmehr, weil es offenlegt, wie weit Amerika von einer postrassistischen Gesellschaft entfernt ist.
Auch der US-Präsident macht sich darüber keine Illusionen und sagt: "Der Rassismus ist tief verwurzelt in der amerikanischen Gesellschaft." Seine Sympathie für die jungen Aktivisten, die seit vier Monaten in Ferguson und seit mehr als zwei Wochen in Dutzenden Städten protestieren, verbirgt Obama nicht. Bei seinem Treffen mit ihnen im Weißen Haus hätten diese geschildert, dass sie sich drangsaliert und ständig verdächtigt fühlen. "Dieses Gefühl kenne ich, so ging es mir mit 17 oder 18 auch", sagt Obama, ohne näher ins Detail zu gehen.
Obama wünscht sich weitere friedliche Proteste
Um Fortschritte zu erzielen, brauche es Beharrlichkeit. "Die Proteste sind nötig, solange sie friedlich sind. Ansonsten sind sie kontraproduktiv", mahnt Obama. Er verspricht, sich persönlich darum zu kümmern, dass dieses "amerikanische Problem" gelöst werde. Er sei in dieser Frage aber optimistisch, denn die Lage habe sich in den vergangenen 50 Jahren verbessert: "Wenn Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Onkeln sprechen, werden sie Ihnen sagen, dass die Dinge besser sind - nicht gut, aber besser."
Gewiss: Obama ist sich genau bewusst, in welch schwieriger Position er sich befindet und spricht dies auch aus. Als ihn Moderator Jeff Johnson fragt, ob er nicht "aggressiver" seine Meinung sagen müsse, entgegnet der US-Präsident, dass er doch deutlich gemacht habe, dass das Problem der Polizeigewalt existiere und nicht auf Einbildung von Schwarzen und Latinos beruhe. "Ich denke, die Leute würden gerne von mir hören, welche Entscheidung der Jury ich mir gewünscht hätte. Aber das kann ich nicht, denn ich bin Chef der Exekutive und kann dem Justizministerium keine Vorgaben machen."
Er wolle es den Leuten überlassen, darüber zu spekulieren, worüber er nachgrüble oder was er zu seiner Ehefrau Michelle sage, wenn sie abends allein seien. Die Tatsache, dass Millionen Amerikaner das Video gesehen hätten, wie Eric Garner von einem weißen Polizisten gewürgt wird, könnte eine Debatte anstoßen: "Mitunter müssen verstörende Dinge geschehen, damit sich Gesellschaften verändern." Ihn stimme hoffnungsvoll, dass sich viele junge Weiße an den Demonstrationen beteiligten. Dies erlebe er auch bei den Freunden seiner Töchter: "Die weißen Jugendlichen sind heute viel offener, jede Generation geht besser mit anderen Rassen und Kulturen um."
Obama-Berater fürchten Kritik der Konservativen
Was Obama davon abhält, sich klarer und persönlicher zu äußern, darüber wird seit Tagen spekuliert. Mit dem Sender BET hatte er sich eine Plattform ausgesucht, die ihn eindeutig als "ihren Präsidenten" ansieht und ihm große Sympathie entgegenbringt, was dieser Tweet belegt.
Die Washington Post fasst die gängigste Theorie in diesem Artikel zusammen: Obamas Berater warnen davor, sich zu eindeutig zu äußern, da ihm dies nur politisch schaden werde. Er war von den konservativen Medien attackiert worden, als er sich persönlich über die tödlichen Schüsse auf Trayvon Martin äußerte - und als er die Polizei in Massachusetts kritisierte, als diese 2009 den schwarzen Harvard-Professor Henry Louis Gates vor der eigenen Haustür verhaftete, weil sie ihn für einen Einbrecher hielt (Details hier). Wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Ausschnitts des Interviews mit BET erhob die konservative Nachrichtenseite Breitbart News den bekannten Vorwurf, Obama setze "offen die Rassenkarte" ein.
Diese Erfahrungen, so vermutet Kimberlé Williams Crenshaw vom African American Policy Forum im Gespräch mit der Washington Post hätten dazu geführt, dass Obama nun vor allem in der dritten Person oder sehr allgemein über Fragen des Rassismus in Amerika spreche.
Welch starke Wirkung es hat, persönliche Erfahrungen offen auszusprechen, beweist ein anderer Demokrat. Bill de Blasio, der weiße Bürgermeister von New York, ist mit einer Afroamerikanerin verheiratet und berichtete gemeinsam mit ihr in einer Talkshow am Sonntag, wie sie ihren 17-jährigen Sohn Dante auf das Leben eines schwarzen Manns in Amerika vorbereiten: "Tu alles, was ein Polizist sagt. Beweg dich nicht zu schnell, greif nicht in die Tasche zu deinem Handy."
Die Botschaft von de Blasio ist die gleiche wie jene von Obama, aber sie wirkt anders, weil sie mit der Familienerfahrung verknüpft ist. New Yorks Bürgermeister spricht aus, was viele Weiße in den USA nicht wahrhaben wollen: "Ein schwarzes Kind wächst anders auf als ein weißes Kind. Das ist die Realität."
Linktipps:
- "Die Beweiskraft jener Dinge, die nicht ausgesprochen werden": Der interessante Artikel von Ta-Nehisi Coates für den Atlantic ist hier nachzulesen.
- Der afroamerikanische Historiker Jelani Cobb setzt sich in einer Kolumne für das Magazin The New Yorker mit Obamas Reden zu Ferguson und den Bürgerprotesten auseinander.
- "Obamas Farbenlehre": In diesem SZ-Leitartikel wird das Verhältnis des ersten schwarzen Präsidenten zu seiner Rasse debattiert.