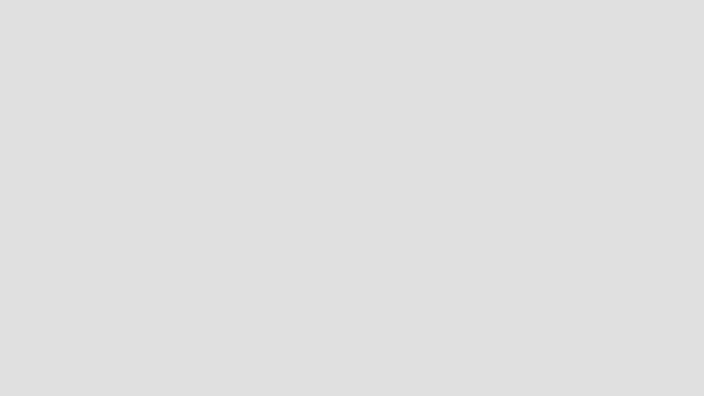Einmal zum Mond zu fliegen, das scheint einer der immer wiederkehrenden Träume amerikanischer Präsidenten zu sein. John F. Kennedy verstand das durchaus wörtlich, seine Nachfolger sprachen davon eher im übertragenen Sinne. Sie meinten eine übermenschliche Leistung, die - wenn überhaupt - von Amerikanern zu erbringen wäre. Auch Barack Obama hat so ein utopisches Ziel vor Augen, wie es der Mondflug für seinen Vorgänger Jahrzehnte zuvor war: Anfang des Jahres kündigte er eine neue "Mondmission" Amerikas an, die wissenschaftliche Reise in eine Welt, in der Krebs heilbar ist - "ein für allemal", wie er sagte.
Geht so was überhaupt? Wird Krebs jemals heilbar sein - oder so gut zu behandeln, dass sich niemand mehr vor einer Krebsdiagnose fürchten muss? Realistisch erscheint das angesichts der Zahlen nicht. Immer noch sterben allein in Deutschland 220 000 Menschen pro Jahr an bösartigen Tumoren. Mehr als doppelt so viele erhalten im gleichen Zeitraum eine Krebsdiagnose. Dennoch, in der Krebsmedizin ist seit einiger Zeit wieder von "Durchbrüchen" die Rede, eine Vokabel, auf die man lange verzichtet hatte. Und wenn man Mediziner fragt, ob sich denn wirklich etwas getan habe, wird man förmlich von Optimismus überrollt.
"Aus vollem Herzen: Ja, wir erleben derzeit eine Revolution in der Krebstherapie", sagt Ulrich Keilholz vom Comprehensive Cancer Center der Berliner Charité. Ähnlich positiv formuliert es Thomas Seufferlein von der Universitätsklinik in Ulm: "Wir können sicher sagen, dass es deutliche Fortschritte in der Behandlung gibt." Zwar kämen diese Fortschritte derzeit nur einer kleinen Gruppe von Patienten zugute. Dazu zählten aber unter anderen Kranke, denen man bislang nicht habe helfen können. "Und wir verfügen jetzt über zwei Strategien, die Hand in Hand gehen", erklärt der Fachmann für Gastroenterologie.
Die Immuntherapie war schon abgeschrieben - doch dann passierte eine Sensation
Da ist zum einen die Präzisionsmedizin, die hauptsächlich auf die vielen neuen Erkenntnisse aus der Genetik zurückgeht. Krebs ist im Wesentlichen auch eine genetische Erkrankung: Normale Zellen entarten, weil sich ihr Erbgut verändert, und zwar so, dass die Kontrolle über das Wachstum verloren geht. Mit der Zeit entwickelt jeder einzelne Tumor ein typisches Muster solcher Veränderungen - und dieses Muster liefert Hinweise darauf, auf welche Wirkstoffe der betreffende Patient am besten ansprechen könnten.
In einigen Fällen lassen sich sogenannte Treibermutationen ausmachen, also Veränderungen in Genen, die eine zentrale Rolle für das Krebswachstum spielen. Daher wird ein Krebs immer häufiger auf solche Gene hin untersucht oder sogar vollständig sequenziert. Einige Patienten erhalten dann eine sehr gezielte Behandlung. Fachleute sprechen von Targeted Therapy. Bekannt sind Treibermutationen heute vor allem beim Lungenkrebs und beim schwarzen Hautkrebs.
Noch größer sind die Erwartungen auf dem zweiten Feld, der Immuntherapie. Impfungen, Zellen und vor allem spezialisierte Eiweiße, die Antikörper genannt werden, mobilisieren die körpereigene Abwehr gegen den Tumor. Mit teilweise spektakulären Erfolgen. Ärzte berichten von Fällen, in denen Tumoren und Metastasen regelrecht schmelzen. Die Immuntherapie beeindruckt aber nicht allein durch ihre Resultate. Sie zeigt auch, wie wichtig ein langer Atem in der Forschung sein kann. Denn die körpereigene Abwehr gegen Krebs zu richten, ist eine mehr als 120 Jahre alte Idee; schon Ende des 19. Jahrhunderts versuchten Ärzte, das Immunsystem von Tumorpatienten mit Bakterien zu stimulieren. In Einzelfällen sogar mit Erfolg, was sich damals allerdings niemand genau erklären konnte.
Rationale Ansätze kamen erst ein Jahrhundert später ins Spiel. "Man hat damals versucht, den Krebs gezielt an seinen besonderen Merkmalen zu packen, das Immunsystem mit Impfungen auf diese sogenannten Antigene abzurichten", erinnert sich Ulrich Keilholz. Das Prinzip glich einem Vakzin, wie man es von Masern oder Röteln her kennt. Der Impfstoff zeigt dem Immunsystem, worauf es sich stürzen soll - und lässt den Körper den Rest erledigen. Tatsächlich prägten sich Immunzellen die Kennzeichen des Krebses nachweislich ein. Aber wirksam bekämpfen konnten sie die Tumoren trotzdem nicht. "Anfang dieses Jahrtausends musste man einsehen, dass auch die Impfungen nicht effektiv sind", erzählt Keilholz.
"Das System ist durch die Euphorie im Moment etwas überhitzt"
Der Immuntherapie gegen Krebs drohte also das endgültige Aus, als Forscher in den USA einen anderen, neuen Ansatz an einem guten Dutzend hoffnungsloser Hautkrebsfälle testeten. Im Mittelpunkt stand ein Effekt, den man in den Jahren zuvor in der Grundlagenforschung entdeckt und untersucht hatte. Demnach wird das Immunsystem auf Krebszellen zwar aufmerksam. Manche dieser Krebszellen aber besitzen ein Art Tarnung, ein Signal, mit dem sie die Körperabwehr täuschen. "Der Tumor sagt: Halt, ich bin ein Freund", erklärt Seufferlein.
Vermittelt wird die Botschaft über Eiweißmoleküle auf der Oberfläche des Tumors, die von Krebsmedizinern als Checkpoints bezeichnet werden. Gegen einen dieser Checkpoints fand man einen Antikörper, mit dem sich das Tarn-Signal blockieren ließ. Schon bei den ersten 14 Patienten, die diesen Antikörper erhielten, waren die Effekte dramatisch: Sechs durchlitten massive Nebenwirkungen, weil ihr Immunsystem heillos überreagierte. Bei drei Patienten aber schrumpfte der Krebs. Bei zweien verschwand er.
13 Jahre liegt die Studie zurück, seither wurde der verwendete Antikörper mit dem unaussprechlichen Namen Ipilimumab gegen zahlreiche andere Krebsarten getestet. Es wurden neue Antikörper entwickelt, die gezielter gegen die Tarnung der Tumorzellen vorgehen und weniger Nebenwirkungen haben. Auch bei Lungenkrebs, Blasenkrebs, an Kopf- und Halstumoren und auch bei einer Brustkrebsart können die Checkpoint-Blockaden manchmal noch in fortgeschrittenem Stadium helfen. Die Experten betonen dabei, dass die neue Immuntherapie meist nur für eine kleine Gruppe von Patienten geeignet ist, in der Regel profitiert nur jeder Zwanzigste. Allmählich zeichnet sich allerdings auch ab, was an diesen Patienten besonders ist.
"Aus den bisherigen Studien lässt sich ein Muster ablesen", sagt Keilholz. "Tumore mit vielen genetischen Veränderungen sprechen auf Checkpoint-Inhibitoren an. Tumore mit wenigen Mutationen sprechen auf diese Therapie nicht an." Für die Immuntherapie zählt demnach, wie auffällig der Tumor dank seiner gesammelten Veränderungen für das Immunsystem aussieht, sobald die Tarnung beseitigt ist. In welchem Gewebe der Krebs wächst, verliert an Bedeutung.
"Die Krebstherapie atomisiert sich", sagt Seufferlein. "Die Grenzen zwischen den vielen Tumorarten, die wir kennen, lösen sich auf." Der Ulmer Krebsexperte hat erlebt, wie sich deshalb selbst bei schwer behandelbaren Krebsarten Türen öffnen: Sogenannte Plattenepithelkarzinome der Speiseröhre zum Beispiel, gegen die es keine gezielte Behandlung gab, sprechen in einigen Fällen sehr gut auf die neue Therapie an.
Gibt es also nur noch zwei Arten von Krebs - einen, den der eigene Körper erledigen kann, wenn man ihm den Weg frei räumt? Und einen, der unsichtbar bleibt für das Immunsystem, dafür dann aber womöglich mit molekularen Therapien behandelt werden kann? Ganz so einfach ist es wohl nicht. Wo im Körper der Krebs wächst, entscheidet durchaus noch darüber, wie stark sich der Krebs ändert. Eine Form des Lungenkrebses und auch der schwarze Hautkrebs sammeln im Laufe ihres Wachstums häufiger Mutationen an als Tumoren in anderen Geweben. Deshalb sind Checkpoint-Antikörper wie Ipilimumab oder Nivolumab bei diesen Tumoren auch überdurchschnittlich häufig erfolgreich. Beim Melanom sogar in bis zu 70 Prozent der Fälle, sagt Keilholz. Vor zwei Jahren nannten Experten hier noch 50 Prozent. "Es ist noch viel Luft nach oben da, zum Beispiel, indem man Wirkstoffe kombiniert", sagt der Berliner Onkologe.
Es bleibt aber auch Luft nach unten. Man wisse noch nicht, wie viel besser die Immuntherapie gegenüber etablierten Behandlungsansätzen letztlich sein werde, sagt Seufferlein. "Das System ist durch die Euphorie im Moment etwas überhitzt." Dazu kommt, dass gerade die neuen Immuntherapien mit ihren teils extrem hohen Kosten auch extrem hohe Erwartungen wecken. Während Onkologen in jedem Monat, den ein Patient länger lebt, bereits einen Erfolg sehen, erhoffen sich viele Krebskranke deutlich mehr.
"Wenn es für 60 000 bis 100 000 Euro dann keine Heilung gibt, sondern zehn Monate mehr Lebenszeit - da sind manche schon enttäuscht", berichtet Seufferlein. "Dabei sind echte Heilungen heute immer noch selten - und deshalb auch nicht das erste Ziel." Es gehe vielmehr darum, aus dem Todesurteil eine Krankheit zu machen, mit der man möglichst lange leben kann. Und zwar so, dass das Leben lebenswert bleibt, trotz der Behandlungsphasen - und trotz der Chemotherapie, die für die Mehrheit der Krebspatienten nach wie vor überlebenswichtig bleibt, aber eben auch eine Prüfung. Immerhin, neue Medikamente helfen gegen Übelkeit und Durchfall. Auch das sind wichtige Fortschritte. "Der Patient soll nicht an seinem Krebs sterben", sagt Ulrich Keilholz. "Es soll aber auch nicht an der Therapie zugrunde gehen."