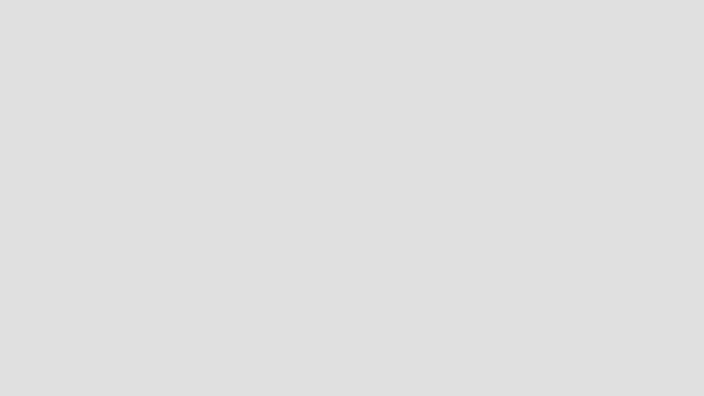In der Jugend, sagt ein Sprichwort, gleiche der Mensch seiner Zeit; im Alter seinen Vorfahren. Wenn dieser Satz je auf einen Autor zutrifft, dann auf Martin Walser. Sein Werk umspannt mehr als sechs Jahrzehnte, und er hat die deutsche Literatur in dieser Zeit entscheidend geprägt. Dabei bleibt er, auch wenn es auf Anhieb nicht so aussieht, immer derselbe.
Am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, wurde Martin Walser kurz vor Kriegsende zur Wehrmacht eingezogen. Er studierte Germanistik, promovierte über Kafka, arbeitete schon bald als Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und machte sich, gerade dreißig Jahre alt, einen Namen mit dem Erstlingsroman "Ehen in Philippsburg". Man kann ihn als Auftakt ansehen für die gewaltige Kristlein-Trilogie, wie sie nach ihrem Helden heißt, bestehend aus den Bänden "Halbzeit", "Das Einhorn" und "Der Sturz". Sie führt von den späten Fünfziger- bis in die frühen Siebzigerjahre und zeichnet ein einzigartig exaktes, fesselndes Bild der jungen, langsam reifenden Bundesrepublik.
Anselm Kristlein: Das ist ein Name, der die bodenständige Welt der oberschwäbischen Ahnen zitiert, die er mit seinem Verfasser teilt. Aber es ist ihm nicht vergönnt, dort zu bleiben. Der Zwang, unter wechselnden Verhältnissen Geld für sich und seine vielköpfige Familie zu verdienen, hält ihn beständig auf Trab, und das heißt auf der Höhe der Zeitgenossenschaft, zunächst als reisenden Vertreter für Aussteuerwäsche, dann als Reklamemann eines Feinkost-Fabrikanten, zuletzt, in diesem Rattenrennen todmüde geworden, als Hausmeister eines Erholungsheims.
Den Trümmern des Kriegs entwachsen
Grundsolide sieht sie aus, diese neue Gesellschaft, die den Trümmern des Kriegs entwachsen ist. Sie scheint Wohltaten für alle bereitzuhalten, in Wahrheit aber ist sie voller Fallen. Man muss sogar aufpassen, welchen Namen man seinen Kindern gibt. Anselm bereut es zutiefst, dass er seinen Sohn Guido nannte. Denn wie spricht man das aus? "Guuido", wie man es instinktiv in Deutschland tut, oder "Gwido", wie das italienische Original es verlangt?
Darüber geraten sich auf einer Party der Dichter Dieckow und der bekennende Schwule (damals noch eine echte Kühnheit!) Edmund in die Haare. "Edmund und Dieckow fochten weiter. Edmund warf Dieckow vor, es sei 'typisch deutsch', alles deutsch auszusprechen. Dieckow warf Edmund vor, 'typisch deutsch' sei es, alles ausländisch aussprechen zu wollen, jeder wollte dem anderen nachweisen, er sei 'typisch deutsch', jeder wehrte sich dagegen, weil 'typisch deutsch' zu sein offensichtlich das Schlimmste war, was einem nachgesagt werden konnte. Je länger ich zuhörte, desto ratloser wurde ich."
Anselm würde am liebsten wegtauchen von diesem unseligen Streit und erwägt, seinen Sohn von nun an Gustav oder Georg zu rufen. Aber am Ende führt kein Weg an der trüben Einsicht vorbei: "Vielleicht ist es sogar 'typisch deutsch', dass jeder bei uns das, was er nicht mag, 'typisch deutsch' nennt." Das ist eine Einsicht, zu der keines der beiden sich erbitternd bekämpfenden deutschen Lager, weder das konservative noch das progressive, je für sich hätte gelangen können. Nur wen die angstgeborene Hellsicht befähigt, illusionsfrei das Bild des Ganzen zu sehen, erkennt, wie das zusammenhängt; wie untrennbar sich diese Feinde zu einem einzigen Knäuel verbeißen. Martin Walser war stets wie kein anderer der Autor des "typisch Deutschen", das mit sich selbst in ewigem Hader liegt, und er ist es noch immer.
Die Zwickmühle, die sein Thema ist
Mehr als einmal geriet er selbst in die Zwickmühle, die sein Thema ist. Links war er, in den Sechzigern, als ihm das nicht helfen konnte; und dass er es ausgerechnet mit der doktrinären DKP hielt, isolierte ihn noch innerhalb des linken Flügels. Später, als die Gesellschaft insgesamt den Schwenk zur Sozialdemokratie vollzogen hatte, erwarb er sich einen Ruf als verstockter Reaktionär. In den Achtzigerjahren reiste er in die DDR, nach Sachsen und Thüringen, und fühlte dort gerührt das alte Herz des deutschen Geistes schlagen. Das ließ ihn als unbelehrbaren Revanchisten erscheinen, in einer Zeit, die nicht ahnte, wie nah sie in Wahrheit bereits der deutschen Vereinigung war.
Als er 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegennahm, schaffte er es bei seiner Dankesrede mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit, alle jene vor den Kopf zu stoßen, die ihm diesen Preis verliehen hatten, indem er Zweifel an der deutschen Gedächtnis- und Bewältigungskultur äußerte. Und eine Figur, die Marcel Reich-Ranicki, dem Kritiker, der ihn verrissen hatte, zumindest ähnelt, ließ er in dem kleinen Roman "Tod eines Kritikers" kurzerhand ermorden (wenigstens zum Schein) - was ihm den hierzulande tödlichen Vorwurf des Antisemitismus eintrug. Mit welch scharfem Blick er in den Sechzigern den Auschwitz-Prozess und dessen Aufnahme in der Öffentlichkeit verfolgt hatte, geriet dabei in Vergessenheit.
Auf eine typisch deutsche Weise unpolitisch
Nie passte, was er gedacht hat, zu den präformierten Fronten; und so wurde er beargwöhnt von allen. Anders als Günter Grass, der gleichaltrige Ruhmesgenosse, der aus seinen Skandalen gestärkt oder mindestens neu profiliert hervorging, zwängte sich Walser bei diesen Affären stets so unvorteilhaft wie möglich ein. Statt des politischen Autors, der er wenigstens zu gewissen Zeiten gern gewesen wäre, blieb er doch insofern auf eine typisch deutsche Weise unpolitisch, als er die Wirkungen nicht absah, die er hervorrief. Und reagierte darauf mit einer treuherzigen Bockigkeit, die alles noch schlimmer machte.
Bis in die zweite Hälfte der Siebzigerjahre präsentierte er sich primär als Kritiker der Gesellschaft. Danach schien er eine scharfe Kehrtwende zu vollziehen und sich ins bürgerliche Leben mit seinen umgrenzten Konflikten zurückzuziehen. Das erste Buch, das nach dieser Zäsur entstand, die Novelle "Ein fliehendes Pferd" von 1978, machte den Außenseiter auf einmal zum Bestsellerautor. Doch was er und seine männlichen Helden, die langsam mit ihm zusammen alterten, sich nach wie vor bewahrten, war ihr schlechthin erstaunter Blick auf alles, was der Fall ist.
Nichts wollen sie intensiver, als dazuzugehören; und die zahllosen Misshelligkeiten auf dem Weg dorthin bilden das eigentliche Element des oft verkannten Walserschen Humors. In dem Roman "Angstblüte" von 2006 (Walser weiß genau, dass allein die Angst unser Bestes hervorzwingt) lässt er, mit allen Zeichen der Einfühlung, den Hedgefonds-Manager Karl von Kahn auftreten, der durch seine salbungsvolle Art das Vertrauen der teils steinalten Anlegerinnen errungen hat.
"Wenn wir aber den Zinseszins erleben, erleben wir Religion"
Von dort fällt ein Blick auf das, was Geld überhaupt sei: "Das Absahnen, Gewinnmitnehmen samt Geldausgeben ist die triviale Dimension. Ich sage verständnisvoll: die irdische Dimension. Wer aber Geld spart und verzinst, erlebt den ersten Schauer der Vermehrung. Ich sage: der Vergeistigung. Der Zins ist die Vergeistigung des Geldes. Wenn der Zins dann wieder verzinst wird, wenn also der Zinseszins erlebt wird, steigert sich die Vergeistigung ins Musikgemäße. Das ist kein Bild, kein Vergleich, das ist so. Die Zinseszinszahlen sind Noten. Wenn wir aber den Zinseszins erleben, erleben wir Religion. (...) Spürbar wird Gott."
Hier gelingt wie nebenbei die mystische Wesensschau des Kapitalismus. Seine Nutznießer üben ihn aus, ohne ihn je zu reflektieren, seine Gegner beschränken sich darauf, seine destruktiven Konsequenzen sauertöpfisch anzuprangern. So bleibt er in seinem Ganzen wesentlich unbedacht. Man muss eine blasphemische Art von Unschuld mitbringen, um es auszusprechen zu können: Das Konzept des Geldes stellt, neben der Religion, die zweite große metaphysische Leistung der Menschheit dar. Gott mag man leugnen; das Geld ist da.
Andacht zum Obszönen
Es lässt sich dieser Passage eine gewisse Andacht zum Obszönen bescheinigen. Sie zeichnet Walser auch und besonders dort aus, wo er von der Liebe spricht; und das tut er eigentlich ununterbrochen. Man kann die "Halbzeit", die unter so vielen Dutzenden seiner Bücher im Lauf der Jahrzehnte doch wohl das größte bleibt, als den schlechthin gültigen Gesellschaftsroman der BRD lesen - oder als ein Werk der verzweifelten Liebe. Mit zwei, drei, vier Geliebten muss sich der umtriebige Anselm parallel auseinandersetzen, wohlgemerkt neben einer Ehefrau, die strikt auf die Einhaltung der "Eheabende" sieht.
Walsers Helden fühlen sich von der Ehe erstickt, aber keiner will auf sie verzichten, so wenig wie auf seinen bürgerlichen Brotberuf. Die Inständigkeit des Begehrens ist getönt und unterfüttert von Angst, die den Liebes- so gut wie den Geldmarkt beherrscht; so findet sie niemals aus dem Grundzustand der Unruhe heraus und wird umso treuloser, je bedürftiger sie ist.
Mit dem zunehmenden Alter Walsers und seiner Protagonisten tut sich die Schere zur jugendlich begehrenswerten Frau immer weiter auf. Der Abstand erreicht zwei, drei, ja selbst vier Jahrzehnte. Die Männer, die solche Liebe erleiden, sind über ihre Aussichten sehr im Zweifel und ihrer sozialen Missbilligung gewiss. Walser benützt die Schamlosigkeit der Sexszenen geradezu als Wünschelrute, die bei seinen älteren Herren die Adern des wahren Gefühls aufspürt.
Man sage nicht, es gebe heute keine Tabus mehr: Walser trifft sie alle, etwa im Roman "Der Augenblick der Liebe". "Er hätte die Damen wirklich fragen müssen, warum ein Älterer, wenn er denn das war, was sie geil nannten, nicht einfach geil, sondern altersgeil war. Die hatten da eine Ahndung parat. (...) Und weil das so ist, weiß Gottlieb, dass er, was bei ihm altersgeil genannt werden konnte oder musste, zu verbergen hatte, so wie er als Fünfzehnjähriger seine Jugendgeilheit zu verbergen hatte. Es gab Damen und Herren im Ächtungsdienst für jedes Alter."
Bücherschreiben als Privatprojekt
"Ächtungsdienst", da spricht ein Ressentiment, das doch die vernünftigsten Überlegungen auf seiner Seite hat. Welches Recht haben die gehobenen Damen, das Sexualleben ihrer männlichen Mitbürger polizeilich oder mindestens spitzelmäßig zu überwachen? Der Altersunterschied zwischen Mann und Geliebter wächst in Walsers Prosa auf zuletzt mehr als sechzig Jahre an. In "Ein liebender Mann" schlüpft Walser in die Haut des alten Goethe, der - vergeblich - um die siebzehnjährige Ulrike wirbt. Man liest es mit sehr gemischten Empfindungen. Aber sobald man Walser selbst daraus vorlesen hört, kann man nicht anders, als Achtung vor so viel Unerschrockenheit zu empfinden. Widerstrebend erkennt man das Höchstpersönliche solchen Schreibens als eine Qualität, die nicht mehr völlig in Literatur aufgeht. Walser, der sehr alte Walser, betreibt das Bücherschreiben zunehmend als Privatprojekt, bei dem wir ihm zuschauen dürfen, aber bitte nicht mehr stören sollen.
Nur so versteht man ein Spätwerk wie "Muttersohn". Augustin Feinlein ist Chef einer psychiatrischen Anstalt in einem ehemaligen Kloster am Bodensee, ganz nah an Walsers Heimat, von wo er stammt und wo er bis heute lebt. Man muss kein besonders scharfsinniger Interpret sein, um in diesem Augustin Feinlein einen Anselm Kristlein zu erblicken, der den vollen Kreis seines Lebens ausgeschritten hat. Rücksichten muss er nicht mehr nehmen, und so tut er jetzt ungehemmt, was er schon immer wollte. Aber dabei bleibt er doch im Bann der immer selben "Zustimmungssucht". Nur der Gegenstand solcher Zustimmung hat sich verschoben: Feinlein, nunmehr ohne Scham dem Katholizismus in seiner barocken Form zugetan, stiehlt ein kostbares Gefäß mit Heiligenreliquien, um es ebenso dem Spott der Säkularen wie der verlegenen Skepsis der Theologen zu entziehen. Die Folgen scheren ihn nicht.
Zwei Bände zum Geburtstag
Sein Verlag bringt zum hohen runden Geburtstag zwei Bände heraus, die Walsers Wirken von den Fünfzigern bis in die Gegenwart in einer (freilich geräumigen) Nussschale zusammenfassen. Auf der einen Seite steht "Meßmer", seit den Achtzigern in drei Lieferungen als eine Folge von melancholischen, oft bitteren Reflexionen geschrieben, nun erstmals zusammengeführt (Meßmer. Gedanken. Reisen. Momente. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2017. 331 S., 20 Euro). Meßmer ist Walsers Alter Ego, wenn er sich ganz ins Private zurückzieht. Die Eintragungen bestehen aus wenigen Zeilen, manchmal nur in einer Zeile. Aber sie stellen keine Aphorismen dar, diese immer verdächtigen kleinen Eitelkeiten, sie enthalten sich der Pointe und zielen aufs Allgemeine auf dem Umweg des eigenen Inneren wie bei den Mystikern, die Walser ehrt. "Als es schön war, wusste ich es nicht", kann so ein Satz lauten, oder: "Er hat nicht aufgepasst. Er hat drauflosgeliebt. Frauen, Männer, Motorräder, egal." Oder: "Man könnte. Aber man kann nicht." "Ich" sagen diese Mini-Texte, wo sie um die Fasson der Person ringen, "er", wo sie dieses Ringen von hoch oben wie etwas Aussichtsloses betrachten, und "man", wo ihnen vollends der Mut entsinkt.
Der andere Band, genaues Gegenstück, bündelt Walsers öffentliche Wortmeldungen aus sechs Jahrzehnten, viele davon an zentraler Stelle in der Süddeutschen Zeitung und in der FAZ, in Zeit und Spiegel platziert (Ewig aktuell. Aus gegebenem Anlass. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Thekla Chabbi. Rowohlt-Verlag, Reinbek 2017. 637 S., 24,95 Euro. E-Book 19,99 Euro). Auf ewig aktuell, das ist ein gewollter Widerspruch. Aber er lässt, in der perspektivischen Verkürzung, die durch die Reihung vieler überwiegend kleiner Texte entsteht, doch erkennen, wie Walser, so sehr sich die Umstände und seine Ansichten ändern, dennoch immer bei sich selbst bleibt. Immer geht er letztlich arglos ins verminte Feld der Politik hinein, und immer ist er verwundert über die Gegnerschaft, die ihm entgegenschlägt. Immer verkörpern sich ihm gesellschaftliche Konstellationen in Menschen, die er als persönliche Feinde erlebt oder in überschwänglicher Zustimmung bejubelt.
Gegnern, die sich nicht mehr wehren können, schreibt er gern versöhnliche Nachrufe
In den jüngsten Texten spricht er Angela Merkel und Wolfgang Schäuble sein rückhaltloses Vertrauen aus, da sie die Flüchtlinge und das bankrotte Griechenland nicht fallen ließen. Das hat ihm nicht nur Freunde eingebracht. Auch die berüchtigte Paulskirchenrede von 1998 lässt sich hier noch einmal nachlesen. Man kann verfolgen, wie sie zunächst recht lose umherschweift, als hätte sie den Redner (ganz wie er es auch behauptet) in einem geistesabwesenden Moment ereilt, und wie ihr Ungeschick einem verhaltenen Groll entspringt. Walser hat sich für den Anlass eindeutig nicht genug zusammengenommen.
Aber was man daraus gemacht hat, indem man die "Moralkeule" und das "fußballfeldgroße Feld unserer Schande", das Berliner Holocaust-Denkmal, völlig isoliert und so böswillig wie möglich interpretierte, das hat er nicht verdient. Walser spricht (das wollte man nicht wahrhaben) zuletzt von der Scham darüber, dass mit einem Phänomen wie Auschwitz Politik getrieben wird.
Doch wer ein so hohes Alter erreicht, der genießt das Privileg, seinen Gegnern, die sich nicht mehr wehren können, versöhnliche Nachrufe zu halten. So ergeht es Rudolf Augstein, Marcel Reich-Ranicki, Günter Grass und dem sehr viel jüngeren Frank Schirrmacher. Zum Tod von Reich-Ranicki heißt es: "Auf einmal sehe ich, ich hätte mich nicht über ihn ärgern müssen, weil seine temperamentsbedingte Art, auf mich zu reagieren, immer genauso viel über ihn gesagt hat wie über mich."
Wen außer Martin Walser gäbe es in der deutschen Literatur, der so für die gesamte lange Epoche seit Gründung der Bundesrepublik bis heute einsteht? Er ist, so ungern das einige Zeitgenossen hören mögen, unser schlechthin klassischer Autor. Mit neunzig hat mancher sich selbst überlebt. Walser ist seine Hochbetagtheit zum Segen geworden wie einem biblischen Patriarchen. Und er schreibt weiter.