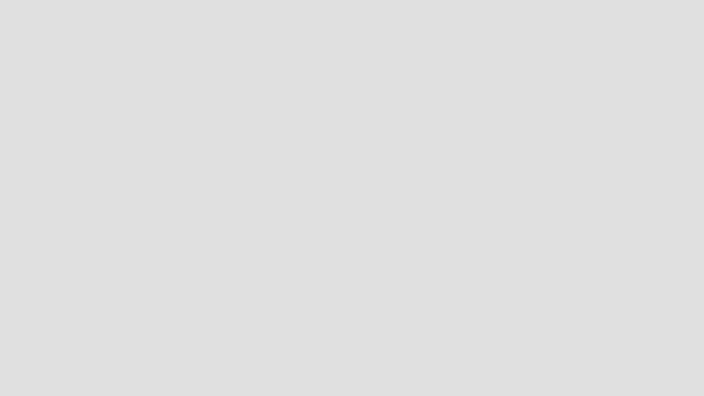Peter Weger, der Stadtarchivar, sitzt in einem alten Klassenzimmer vor einem kastenförmigen Computer und schaut sich auf Youtube die Sprengung des Braunkohlekraftwerks Arzberg an. "Oh weh!", ruft er, als der Kühlturm in sich zusammenstürzt und schlägt sich die Hände vors Gesicht. "Was hatten wir alles! Und jetzt ist alles verloren!" Das Kraftwerk gibt es seit sieben Jahren nicht mehr, noch immer fassungslos starrt Weger durch seine verschmierten Brillengläser auf den Monitor. "Fabriken hatten wir! Porzellan! Schuhe! Wäsche!" Jeder Satz ein Ausrufezeichen. Er druckt ein paar Artikel über frühere Arzberger Fabriken bei Wikipedia aus.
Peter Weger ist 74 Jahre alt, er arbeitete erst in der Stadtverwaltung, als er in Rente ging, übernahm er das Archiv in der alten Schule am Friedhof. Als die Schule schloss vor mehr als 40 Jahren, kam es dorthin. Es sieht noch so aus wie damals, alte Klassenfotos, alte Urkunden, nur dass sich auf den Schultischen jetzt Papierberge türmen und in Vitrinen, die in den Gängen stehen, die Porzellanteller stapeln.
Es sieht so aus, als hätten Weger und seine Vorgänger versucht, hier drinnen die Zeit festzuhalten, die draußen viel zu schnell verging. "Na gucken Sie sich doch an, wie es hier jetzt aussieht!"
Leere Häuser, leere Straßen, Schaufenster, in denen zwar noch Blümchentassen liegen, an deren Scheiben aber schon diese schwarzen Schilder mit Telefonnummer hängen: "Haus zu verkaufen". Arzberg in Oberfranken war einmal eine der Porzellanhauptstädte Deutschlands, so wie Deutschland einmal die Porzellanhochburg Europas war. Es waren 260 Hersteller, 29 000 Beschäftigte, nach der Wende brach alles zusammen. In Arzberg gab es einmal vier Porzellanfabriken, drei sind schon abgerissen, die vierte ist bald dran.
Von Arzberg aus gesehen kann eine Geschichte über Porzellan nur traurig werden. Dabei ist sie gar nicht so traurig - zumindest, wenn sie woanders spielt.
In Arzberg aber kann man so gut wie vielleicht nirgendwo sonst lernen, was Porzellan einmal bedeutet hat. Anneliese Röhrig könnte stundenlang über Porzellan reden. Weil es edel ist, weil es alles schöner macht, den Tisch, den Alltag, das Leben. Ihre Enkelin war schon zweimal Porzellankönigin, das mit dem Porzellan im Blut habe sie von ihr. Röhrig, das weiße Haar in Locken gelegt, 70 Jahre alt, arbeitet im Arzberger Martinslädchen. Ein Laden für Bedürftige, gebrauchte Kleidung, gebrauchte Schuhe, alles für ein paar Euro.
Sie nimmt eine Porzellantasse mit Blumen aus dem Regal und dreht sie um, sodass man den Stempel des Herstellers sieht. Arzberg, ihre Lieblingsmarke. "Das ist die typische Bewegung eines Oberfranken, man will ja wissen, woraus man trinkt, nicht wahr?" Sie lacht. Dann lächelt sie verschwörerisch. "Und wissen Sie, was Sie machen, wenn Sie an einer fremden Kaffeetafel nachschauen wollen? Sie halten ein poliertes Messer unter die gekippte Tasse!" Danach sagt Anneliese Röhrig das, was einem viele hier in Arzberg sagen: "Porzellan ist für mich Heimat. Das weiße Gold zählt halt was." Unter dem Stichwort "weißes Gold" findet man bei Wikipedia heute auch Kokain.
Erst mit dem einenen Service war man bereit fürs Leben
Porzellan, im Januar 1708 von Johann Friedrich Böttger in Dresden erfunden, wird aus Kaolin, Quarz und Feldspat hergestellt. Bevor es in Deutschland erfunden wurde, stritten sich Fürsten und Könige um das weiße Gold aus China, das Marco Polo Ende des 13. Jahrhunderts nach Europa gebracht hatte, und das dann so begehrt wurde wie echtes Gold. Bis ins 19. Jahrhundert blieb es den Reichen und Mächtigen vorbehalten, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte es sich zum nötigen Bestandteil einer bürgerlichen Existenz: Erst wer ein eigenes Service mit Suppenschüsseln und Sauciere zur Hochzeit erhalten hatte, war wirklich bereit fürs Leben.
Das änderte sich nach der Wende: Chinesische Firmen begannen, in großen Mengen billige Porzellan- und Keramikprodukte nach Europa zu verschiffen. Porzellan ist teuer in der Herstellung, personal- und energieintensiv, das Überangebot und die niedrigen Preise waren zu viel für die deutschen Hersteller. Als die EU-Kommission 2012 in einem Anti-Dumpingverfahren Strafzölle gegen chinesische Porzellan- und Keramikimporte erhob, war es schon zu spät: Die meisten Manufakturen und Porzellanfabriken, darunter Arzberg, hatten da längst Insolvenz angemeldet.
Vom Porzellanland sind zwischen zehn und 2o Hersteller und 5000 "Porzelliner" geblieben, heißt es beim Verband der keramischen Industrie, von der kulturellen Bedeutung des Porzellans blieben Museen und falsch verstandene Redewendungen. "Scherben bringen Glück" zum Beispiel: Damit ist eigentlich der Scherben gemeint, also das Stück Porzellan, das zur Hochzeit verschenkt und nicht zerstört wird. Als Statussymbol ist Porzellan heute ungefähr so in Mode wie ein Schlips.
Und doch ist die große deutsche Porzellan-Krise vorbei. Es gibt zwar keine Renaissance der Branche, aber Unternehmen, die verstanden haben, wie sich mit deutschem Porzellan noch viel Geld verdienen lässt. Die wichtigste Erkenntnis dabei: Hübsche Blümchentassen reichen dafür nicht mehr - Tee schmeckt aus einer chinesischen Blümchentasse ja nicht schlechter.
130 Kilometer nordwestlich von Arzberg, in Thüringen, sitzt Holger Raithel an einem Konferenztisch mit Keksen auf Flüsterporzellan. Raithel, 45 Jahre, ist der Geschäftsführer von Kahla-Porzellan, durch das Fenster hinter ihm sieht man das Fabrikgebäude aus Backstein, hohe Schornsteine, Anfang des Jahres wurde hier ein Tatort gedreht, Porzellan als Mordwerkzeug. "Wo ist bei einem Wildblumen-Dekor der Mehrwert, den ein Made-in-Germany-Hersteller hat?", fragt Raithel.
Gesellschaft und Tischkultur hätten sich verändert, mehr Single-Haushalte, die Menschen essen seltener zusammen, in den Großstädten werde es enger. Wer brauche da noch ein 25-teiliges Porzellan-Service? Oder gar zwei: eins für den Sonntag und eins für den Alltag?
Wer mit Porzellan Geld verdienen will, muss sich eine Nische suchen
"Wer heute mit Porzellan erfolgreich sein will, muss sich abgrenzen und den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen", sagt Raithel. Den Menschen also in einer Zeit, in der man mit einem Smartphone bereit für das Leben ist, einen Grund geben, hochwertiges Porzellan zu kaufen. Als Grund nennen einem viele Hersteller: "Sie achten doch sonst auch darauf, was Sie in den Mund nehmen, oder?"
Holger Raithel sagt: "Wir sind erfolgreich, weil wir innovatives Design mit Mehrwert machen." Er zeigt auf die weiße Zuckerdose neben dem Keksteller: der Löffel verschwindet in einem Hals, den man auf- und zudrehen kann. Der Zucker bleibt trotz Löffel trocken, im Sommer kommen keine Wespen an die Dose. Dann geht Raithel zu einer Anrichte, auf der mehr Erfindungen stehen. Beschreibbares Porzellan (für Notizen und Liebesbotschaften), Kuschelporzellan (Becher mit Stoffbeschichtung), Flüsterporzellan mit "Magic Grip" (rutscht und klappert nicht; segelbootgeeignet) und natürlich der neue Coffee-to-go-Becher mit Magic Grip. Wer heute mit Porzellan Geld verdienen will, muss sich eine Nische suchen.
Das ist die eine Option. Auch Kahla, 1844 gegründet und jahrzehntelang das Zentrum der Porzellanindustrie in der DDR, war nach der Wende insolvent. Im Jahr 1994 übernahm Günther Raithel, der Vater von Holger Raithel, die Firma, er wollte modernes Porzellan verkaufen.
Zwei Jahre später stellte er ein Service ohne Kaffeekanne vor. Ein Service ohne Kaffeekanne? "Eine Revolution", sagt Raithel, fast schon ein Skandal. Aber wer bitte brauche im Alltag eine Kaffeekanne?
Kahla hat seither viele Designpreise gewonnen, der Umsatz des Unternehmens steigt von Jahr zu Jahr, 2016 waren es 23 Millionen Euro, 300 Mitarbeiter. Für ihn läuft das Geschäft gut, trotzdem sagt Raithel: "Ich finde es traurig, dass es der deutschen Porzellanindustrie nicht gelungen ist, die tollen Produkte, die wir haben, als Begehrlichkeit in die Herzen der Menschen zu bringen." Auf der Liste der Begehrlichkeiten stehe neues Geschirr erst ganz am Ende. Wenn überhaupt.
Ein Stop in Reichenbach, einem kleinen Ort in Thüringen. Hier hat die Manufaktur Reichenbach ihren Sitz, eine der letzten Porzellanmanufakturen in Deutschland. Es geht ja auch um die Frage, ob Porzellan wirklich nur noch ein Alltagsgegenstand ist - oder nicht vielleicht doch noch mehr.
Annett Geithel, die Prokuristin, führt in den Showroom, einen Raum, in dem keine normalen Teller und Tassen stehen, sondern halbseitig in Silber getauchte Becher, Teller mit gezackten Rändern und mit Blumen bemalte Platten. Es ist Kunst. Designerstücke, wo eine Tasse mit Untertasse 50 Euro kostet, Porzellan für Liebhaber.
Richtige Porzelliner erkennt man am Augenleuchten
"Wir fertigen die Kollektionen von Designern und eigene Kollektionen", sagt Geithel. Kleine Stückzahlen, alles, was nicht in einer Fabrik entstehen kann. Es ist schon Abend, sie führt durch die leere Produktionshalle, die Maschinen stehen still, aber das meiste wird hier sowieso mit der Hand gemacht. Löcher ausstanzen, den Scherben mit einem Schwamm formen, Tiere aus mehreren Teilen zusammensetzen. Geithel läuft an Maltischen mit Farbtöpfen und Pinseln vorbei, ihre Augen leuchten, wenn sie erklärt, wie der Scherben gedreht, bemalt und gebrannt wird.
Richtige Porzelliner erkennt man am Augenleuchten, wenn sie über Porzellan sprechen. Denn sie lieben ihren Werkstoff, einen der ältesten der Menschen, er kann 20 000 Jahre in der Erde liegen und genauso wieder ausgegraben werden, er kann fast jede Form annehmen. Wenn er gebrannt wird, schrumpft er um 17 Prozent, stimmt die Form nicht, fällt er in sich zusammen, manchmal ist diese Liebe auch eine Hass-Liebe.
Christian Strootmann, 54, Vorstandsvorsitzender des führenden deutschen Porzellanherstellers, der BHS Tabletop AG, hat keine leuchtenden Augen, wenn er über Porzellan spricht, er ist mehr Geschäftsmann als Porzelliner.
Zurück in Oberfranken, in Selb, dem Ort mit der glorreichsten deutschen Porzellanvergangenheit, wo etwa Rosenthal und Hutschenreuther herkommen. BHS Tabletop, ehemals die Hutschenreuther AG, ist jetzt der Weltmarktführer in der Herstellung von Porzellan für Hotels, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, macht 121 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt 1150 Mitarbeiter.
Strootmann, der früher Düfte und Säfte vermarktet hat, sagt: "Wir verkaufen nicht einfach Teller und Tassen, sondern Dienstleistungen, Servicepakete, Logistikkonzepte, Verlässlichkeit und Design." BHS Tabletop hat sich auf Porzellan in der Außerhausverpflegung spezialisiert - Flugverkehr, Schifffahrt, Krankenhäuser, Kantinen, Altenheime, Restaurants.
Alles, nur kein Haushaltsporzellan verkaufen, das ist die zweite Option. (Ein weiterer Beleg: Auch in der Herstellung künstlicher Hüftgelenke wird Porzellan immer beliebter.)
"Das Porzellan, von dem du isst, das bist du."
In jedem der Bereiche gebe es besondere Anforderungen, sagt Strootmann. Das Geschirr in Flugzeugen muss besonders leicht sein, in Kantinen besonders gut stapelbar, es gibt Teller mit Chips, die das Bezahlen beschleunigen. In Altenheime werden Schüsseln mit zwei Henkeln geliefert, zu Krankenhaustellern passende Plastikdeckel verkauft, den Hygienerichtlinien entsprechend. Auch in Restaurants und Hotels muss Geschirr heute schick aussehen, sagt Strootmann, "es geht um Funktion, aber das Design wird immer wichtiger".
Ein paar Kilometer entfernt in Weiden. Im Werk des Unternehmens sieht man kaum noch Menschen, dafür Roboter, die "stumme Mitarbeiter" heißen. Hier wird nicht gedreht oder bemalt, sondern gepresst, gestanzt, gebrannt, 55 000 Teller pro Tag. Porzellanherstellung, das ist hier industrielle Massenproduktion.
Porzellan, einst Ausdruck von Reichtum und Macht, ist für die meisten Menschen also zu einem Gebrauchsgegenstand geworden, den sie etwa in Form eines Tellers für 1,99 Euro bei Ikea kaufen, ohne darüber nachzudenken, dass es sich dabei eigentlich um Kulturgut handelt.
Es gibt Künstler wie David Lehmann, die glauben, dass sich das wieder ändert. Letzte Station München, Obersendling. Lehmann, Anfang 30, ist Industriedesigner, vor ein paar Jahren hat er im Science-Magazine gelesen, dass keramische Gefäße nicht wie bislang angenommen vor 10 000, sondern vor 20 000 Jahren erfunden wurden. "Das bedeutet: Ein rundes, im Feuer gehärtetes Gefäß ist eines der ältesten Produkte der Menschheit."
Normalerweise macht Lehmann Stühle, Taschen und Kristallgläser, jetzt baut er auf dem Tisch in seinem Atelier ein Porzellanservice auf. Für ihn ist Porzellan Kulturgut, deswegen will auch er Kulturgut schaffen. Sein Service hat sechs Teile, sechs Teile für alles in puristischem Weiß.
Der kleine Becher zum Beispiel kann Eierbecher, Espressotasse, Sauciere oder Eisbecher sein. Alltagstauglich, platzsparend, in Deutschland produziert, Porzellan für die heutige Zeit, sagt Lehmann. Eine Zeit, in der es wichtiger wird, wo Dinge herkommen, wie sie produziert werden, dass sie lange halten. Es ist ein Experiment.
Ein teures Experiment, viele Tausend Euro hat es ihn schon gekostet, seine Freunde haben ihn für verrückt erklärt. Einige Restaurants und Bars verwenden sein Geschirr schon, aber ob es auch Privatpersonen kaufen werden, ob er sein Geld je wiedersehen wird - keine Ahnung. Klar, sei das ein Risiko, sagt Lehmann, aber letztlich gehe es doch darum, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie wichtig einem Esskultur sei. Was man esse, wie man esse - und von was. "Das Porzellan, von dem du isst, das bist du", sagt David Lehmann.