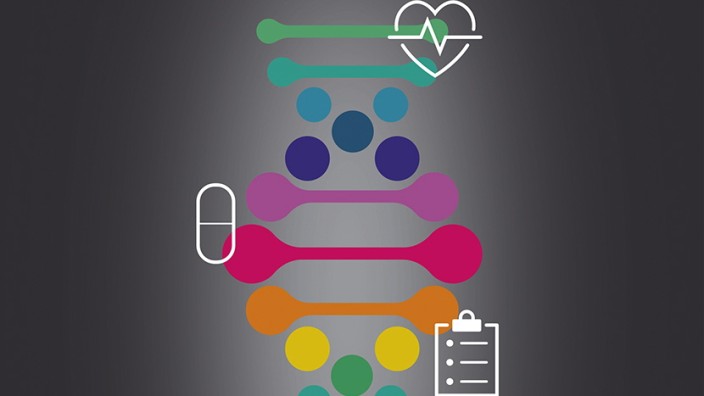Heute kämpfen viele Patienten darum, von ihrem Arzt überhaupt als Person wahrgenommen zu werden. Ein Händedruck ist viel zu selten drin, ein Blick in die Augen wird durch Blättern in der Patientenakte ersetzt. Da fragt man sich, wie es die Medizin schaffen will, den einzelnen Menschen künftig in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit zu rücken. Wie es das geben soll: eine personalisierte, auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Medizin!
Doch diese Art der Medizin ist zweifellos im Kommen. Schon heute gibt es - vor allem in der Krebsbehandlung - zahlreiche Ansätze, Patienten nicht mehr nach dem Prinzip Gießkanne zu behandeln, sondern sich ihre Krankheiten sehr viel genauer anzuschauen als noch vor einigen Jahren üblich. Am Ende erhalten sie Medikamente, die auf ihre persönliche Ausprägung der Krankheit zugeschnitten sind.
Das kann man als eine Art Revolution betrachten. Denn jahrzehntelang sind Mediziner davon ausgegangen, dass alle Menschen als Vertreter derselben biologischen Art mit denselben Methoden behandelt werden müssten, wenn sie krank sind. Inzwischen werden Krankheiten - allen voran Krebserkrankungen - an spezialisierten Zentren genetisch untersucht, vorliegende Mutationen analysiert oder die individuellen Stoffwechseleigenschaften der Patienten detektiert - und je nach Ergebnis greifen Mediziner zu einem anderen Medikament. Nebenwirkungen sollen so minimiert werden, unnötige Therapien, bei denen Patienten Medikamente erhalten, die bei ihnen ohnehin nicht wirken können, vermieden werden.
"Scheinbar ähnliche Krankheiten brauchen bei verschiedenen Patienten ganz andere Medikamente"
Nicht umsonst war das Thema personalisierte Medizin deshalb eines der heiß diskutierten Themen bei der Lindauer Nobelpreisträgertagung, wo Aaron Ciechanover, einer der Chemie-Nobelpreisträger 2004, über Hoffnungen und Grenzen dieser stärker auf einzelne Patienten zugeschnittenen Disziplin sprach. "Für jede Krankheit nur eine Therapie - das war einmal", so der israelische Biochemiker, "scheinbar ähnliche Krankheiten wie Brust- oder Darmkrebs brauchen bei verschiedenen Patienten ganz andere Medikamente."
Das sieht Nisar Malek ähnlich. Der Internist leitet das Zentrum für personalisierte Medizin an der Universität Tübingen. Sein Ziel: die Erkenntnisse dieser Sparte möglichst bald für möglichst viele Patienten verfügbar zu machen. "Wir möchten es in die klinische Routine überführen, dass das Erbgut von Krebsherden untersucht wird, bevor über die medikamentöse Behandlung eines Patienten entschieden wird", sagt Malek. An seinem Zentrum wird dies bisher nur im Einzelfall gemacht - und bei Patienten, für die keine klassischen Therapie mehr zur Verfügung steht, weil sich alles Gängige als chancenlos erwiesen hat.
In solchen Fällen bestimmt Maleks Team die genetische Sequenz der Tumorherde, um einen weiteren möglichen Angriffspunkt beim Krebs zu entdecken. Dabei kann zum Beispiel auffallen, dass bei einer Darmkrebspatientin eine Mutation vorliegt, wie sie üblicherweise bei Lungenkrebs vorkommt. Bei dieser Mutation kann ein modernes Medikament aus der Reihe der sogenannten Checkpoint-Inhibitoren wie PD-1 helfen. Dieses Medikament wäre für die austherapierte Patientin also einen Versuch wert, auch wenn es noch gar nicht für Darmkrebs zugelassen ist.
Dabei liegt Malek aber etwas am Herzen: die kontrollierte Datenauswertung: "Es ist wichtig, dass wir alle Ergebnisse in einer Datenbank sammeln und sorgfältig analysieren." Nur dann könnten andere von dem so erzeugten Wissen profitieren. Denn wissenschaftliche Beweiskraft wird mit zunehmender Individualisierung einer Behandlung immer schwieriger. Würde die Therapie, wenn sie der einen Patientin hilft, wahrscheinlich auch anderen Darmkrebspatienten mit dem gleichen Mutationsmuster helfen? Oder war es nur Zufall? Die Chancen der personalisierten Medizin, ihre Fokussierung auf den einzelnen Patienten, sind zugleich ihr Problem: Jeder Patient ist ein Einzelfall.
Bereits zum 68. Mal findet die Lindauer Nobelpreisträgertagung statt. Von 24. bis 29. Juni diskutieren 39 Laureaten mit 600 Nachwuchs-wissenschaftlern aus 84 Ländern über aktuelle Themen aus Physiologie und Medizin. Die Tagung kooperiert mit dem Heidelberg Laureate Forum (HLF), das seit sechs Jahren nach dem Muster Lindaus etablierte wie junge Informatiker und Mathematiker zu einem einwöchigen Treffen lädt; daher spricht in Lindau der britische Informatiker Leslie Valiant. Die Lindauer Tagung wurde 1951 von den Ärzten Franz Hein und Gustav Parade sowie Lennart Graf Bernadotte initiiert. Sie ist abwechselnd der Physik, der Chemie, der Medizin und dem interdisziplinären Austausch gewidmet. pfu
Ohnehin sagen selbst große klinische Studien nur bedingt etwas über die Chancen einer Arznei im Einzelfall aus. Bei genauerer Analyse zeigt sich mitunter: Insgesamt war der Erfolg eines Medikaments vielleicht mäßig, aber eine Untergruppe von Patienten profitiert deutlich. Zweifelsohne wäre es für Patienten ein Segen, wenn Ärzte den Ausgang einer Therapie bei ihnen persönlich vorhersehen könnten, bevor sie eine Behandlung beginnen.
Heute sei es doch vielfach so, lästert der Genetiker Hans Lehrach, emeritierter langjähriger Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin: Bei einem Patienten ist zwar der linke Arm gebrochen, aber es wird trotzdem sein rechter eingegipst, weil das bei der Mehrheit der Patienten in den klinischen Studien auch erfolgreich war. Und Siddhartha Mukherjee ergänzt: Es müsse gar nicht immer eine helfende Therapie gefunden werden, so der Arzt und Bestsellerautor ("Der König aller Krankheiten") kürzlich in der New York Times. Es sei auch ein wichtiges Ziel, Patienten eine Chemotherapie ersparen zu können, die ihnen nicht helfen wird.
Besser von "Präzisionsmedizin" sprechen
Wie viel Potenzial die personalisierte Medizin hat, wurde Anfang Juni bei der Jahrestagung der American Society of Oncology in Chicago deutlich: Dort präsentierte ein Team vom MD Anderson Cancer Center der Universität Texas eine Langzeitstudie mit 3700 austherapierten Krebspatienten. 711 von ihnen konnten aufgrund einer Mutation, die in ihrem Krebs gefunden wurde, eine spezialisierte Therapie erhalten. Von diesen Patienten lebten nach drei Jahren noch 15 Prozent, von den übrigen waren es nur sieben Prozent.
Der personalisierten Medizin wird häufig vorgeworfen, dass sie am Ende zu kostenintensiv sein werde. Aber bei genauer Betrachtung bedeutet personalisierte Medizin nur im Ausnahmefall eine Spezialbehandlung für den einzelnen Patienten, wie dies bei manchen Immuntherapien der Fall ist - etwa bei der derzeit mit Nachdruck erforschten Car-T-Zelltherapie, bei der die eigenen Immunzellen von Patienten gentechnisch so verändert werden, dass sie den Krebs des Patienten wirksam bekämpfen. In der Regel wäre es besser, von "zielgerichteter Medizin" oder "Präzisionsmedizin" zu sprechen. Patienten werden einer Untergruppe zugeteilt und erhalten innerhalb des Verfügbaren die am besten auf sie zugeschnittene Therapie.
Dabei werden Patienten auch nicht unbedingt menschlicher behandelt. Die Bioethikerin Barbara Prainsack vom King's College London befürchtet sogar, dass die personalisierte Medizin Arzt und Patient noch weiter auseinanderrücken wird. Personalisiert bedeute leider nicht persönlich, so Prainsack. Irgendwann werde womöglich nur noch ein Datensatz des Patienten am Computer erstellt und dieser dann von einem Algorithmus analysiert, der die erfolgversprechendste Therapie auswirft.
Genau das fände Hans Lehrach klasse. Der Molekularbiologe war eine der Größen der frühen Genforschung. Mit einem Team des Comprehensive Cancer Center an der Berliner Charité arbeitet er an einem Tumoranalyseprogramm. Das Team legt im Computer digitale Doubles seiner Patienten an und lässt den Rechner testen, welche Medikamente am besten helfen können. "Wenn wir ein Hochhaus bauen", sagt Lehrach, "warten wir schließlich auch nicht, ob es beim nächsten Sturm zusammenbricht, sondern wir simulieren das im Voraus." Erste Erfolge bei Patienten, die als austherapiert galten, gab es schon.
"Es wird noch Generationen von Ärzten dauern, bis wir die Technik voll ausschöpfen können"
Längst hat die personalisierte Medizin außerhalb der Onkologie weitere Bereiche erobert. Florian Holsboer, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, hat Labortests entwickelt, um vorherzusagen, auf welche Medikamente Patienten mit Depressionen am besten reagieren. Denn auch hier bietet sich häufig das Bild: Ärzte probieren lange aus, wundern sich mitunter, weshalb sich die Krankheit eines Patienten gar nicht bessert, und verdächtigen ihn mitunter sogar, seine Medikamente nicht zu nehmen.
Und an der Medizinischen Universität Wien nutzt der Allergologe Heimo Breiteneder genetische Analysen, um vorherzusagen, ob ein Patient auf eine Immuntherapie reagieren wird. Bisher werden bei Heuschnupfen Extrakte aus ganzen Pollen der quälenden Pflanze hergestellt. Diese enthielten aber nicht immer die für den einzelnen Patienten beste Zusammensetzung an Allergenen, sagt Breiteneder. Er erzählt von einem Bienengiftallergiker, der nach einem Stich trotz mehrjähriger Immuntherapie einen Schock erlitt. Es stellte sich heraus: Von der Substanz "Api m 3" aus dem Bienengift, gegen die sein Immunsystem so rebellierte, war in der Immuntherapie nur wenig enthalten.
In alle Bereiche der Medizin wird die Personalisierung wohl nicht vordringen. Sie ist aufwendig und teuer und gar nicht überall nötig. Gerade Volkskrankheiten wie Herzleiden und Diabetes sind in ihrer Ausprägung oft ähnlicher als Krebs- oder immunologische Erkrankungen; deshalb ist eine Aufteilung der Patienten in Untergruppen nicht immer sinnvoll, meint Malek. Und wie groß können die Erfolge bei den übrigen Krankheiten sein? Kritiker bemängeln mitunter, dass die personalisierte Behandlung Krebspatienten oft nur ein etwas längeres Leben schenke. Das werde mehr werden, meint Malek. Er ist sich sicher: Die Zukunft hat erst angefangen. "Wir stehen noch ganz am Anfang. Es wird noch Generationen von Ärzten dauern, bis wir die Technik voll ausschöpfen können."