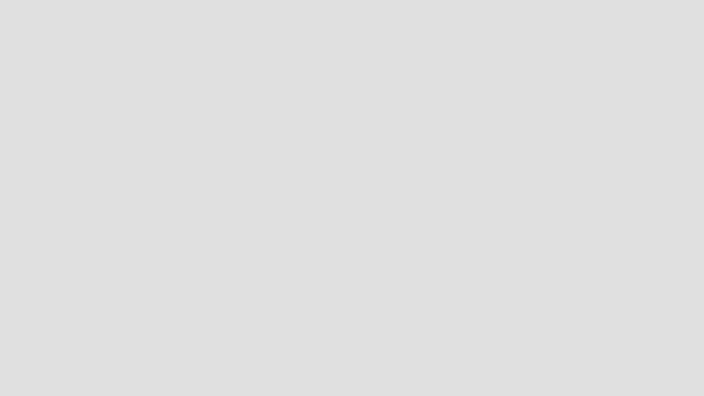Wer wissen will, ob Titus Hambo noch ein Kind war, als er den Kraal verließ, jene mit Dung verputzten Hütten im Halbkreis um den Ziegenpferch, die Fliegenschwärme und die Wüste, der muss ihn nur zum Lächeln bringen: Da sind zwei Reihen intakter Schneidezähne. Wenn ein Himba-Junge 13 wird im Kraal, schlägt man ihm mit einem Stock aus Mopaneholz die vier unteren Schneidezähne aus. "Tradition", sagt Titus, "so werden bei uns aus Jungen Männer."
Seine Mutter aber wollte, dass wenigstens ihr Jüngster in die Schule geht, und so nahm sie Titus an die Hand und zog zu einem Onkel, 60 Kilometer weiter nach Sesfontein. "Und ich", sagt Titus mit seinem makellosen Lächeln, "kann zubeißen wie eine Hyäne. Sesfontein hat mein Gebiss gerettet."
Sesfontein: kein Rettungsanker auf den ersten Blick. Ein paar Dutzend dahingestreute Zementblockhütten, wellblechgedeckt, aus denen staubgetränkte Satellitenschüsseln ragen, magere Hunde, die dazwischen im Unrat scharren. Doch Titus sagt: "Ein guter Ort." Sesfontein liegt mitten in Namibia und dennoch an der Grenze; dort, wo das Land der Damara endet und das Kaokoveld beginnt, das Siedlungsgebiet der Himba.
"Sesfontein", sagt Titus, "ist der Ort, an dem man zueinander kommt." Vor dem kleinen Gemischtwarenladen steht ins Gespräch vertieft ein Grüppchen, das sich anhand des Kopfschmucks zuordnen lässt: eine Frau mit dem typischen Dreispitz der Herero, ein Mann mit kleinem Hütchen, wie es die Damara gerne tragen, ein Himba-Mädchen mit zwei ins Gesicht geflochtenen Zöpfen. "In der Schule", sagt Titus, "haben wir erst mal Afrikaans gelernt, damit wir uns untereinander verstehen. Dann Englisch. Und ein paar von uns später auch noch Deutsch."
Nur einen Steinwurf hinter Titus' Schule weht schwarz-rot-gold die deutsche Flagge an der Zufahrt zu dem Bauwerk, das dem Ort den Namen gab: Fort Sesfontein, ein Fort wie aus einem Kinderspielzeugkatalog, quadratisch, mit einem zinnenbewehrten Turm an jeder Ecke. 1896 bauten die deutschen "Schutztruppen" hier bei den "sechs Quellen" einen Vorposten, doch schon 1914 gab man das Fort wieder auf. Auf dem Friedhof außerhalb der Mauer liegen in drei ordentlich gepflegten Gräbern zwei Unteroffiziere und ein Gefreiter.
Das Fort selbst ist heute eine komfortable Lodge, mit einem Pool im Innenhof, eingerahmt von Bougainvillea, Hibiskus und Jasmin. Manchmal kommt Titus hier vorbei, um Gäste abzuholen, auf ihrem Weg zu einem Himba-Dorf. Ein Besuch eines traditionellen Kraals ist Pflichtprogramm für Reisende im Kaokoveld. "Wir sind berühmt", sagt Titus.
Er selbst bleibt lieber im Hintergrund, wenn er eine Gruppe in ein Dorf seiner alten Heimat bringt, an diesem Tag nach Onganda, von Sesfontein nur eine halbe Stunde mit dem Geländewagen. Die Männer sind, wie meistens, draußen zwischen Dornen und Geröll mit ihren Rindern und Ziegen. Die Frauen sitzen wortkarg vor einer Handvoll schlichter Lehmhütten, die Kinder nackt und neugierig dazwischen. Und die Besucher tasten sich voran, vorsichtig, zögernd, Schritt für Schritt, wie Weltall-Reisende auf einem fremden Planeten.
Onganda scheint aus der Zeit und aus dem Raum gefallen zu sein, kein Strom, kein Wasser und kein Müll, keine Kleidung, keine Möbel, kaum Besitz: nur ein paar Felle, Töpfe, Messer, im Staub unter den Dornakazien Drahtreste und Benzinkanister. Ein Halbwüchsiger, der ein paar Brocken Englisch kann, versucht sich mit Erklärungen: das Heilige Feuer, Kultstätte und Verbindung zu den Ahnen, östlich davon die Häuptlingshütte und dazwischen eine Linie, die kein Fremder überschreiten darf.
Der Schmuck der Mädchen, Messingringe, Muschelketten, Leder, Federn, an denen man ablesen kann, wer unverheiratet ist oder schon Kinder hat, die ockerfarbene Paste aus zermahlenem Roteisenstein und Ziegenfett, die die Frisuren der Himba-Frauen formt, der Gehstock aus Mopaneholz, zwingender Begleiter für die Männer.
"Es hat sich nicht viel verändert hier", sagt Titus, "bis auf das Geld aus dem Schmuckverkauf an die Touristen." Und so liegt bei manchen Häuptlingsfrauen unter den Ziegenfellen in der Hütte jetzt ein Smartphone - ohne Netz. Empfang gibt es erst in Opuwo, der Provinzhauptstadt des Kaokovelds, einem einfallslosen Schachbrett aus Gewerbebauten rund um einen perfekt klimatisierten Supermarkt.
Auf den spiegelblanken Fliesen vor dem Kühlregal steht eine Himba-Frau mit nichts am Leib außer Schmuck und einem Lendenschurz, rechts ein Neugeborenes an der Brust, links in der Hand eine Tüte konfettibunter Marshmallows. "Und abends", sagt Titus, "fährt sie in ihren Kraal zurück und zieht einen Dornbusch in den Eingang ihrer Hütte, als Schutz vor den Löwen."
Draußen verkaufen die Frauen traditionellen Schmuck, drinnen gibt es Gugelhupf
Auch Titus ist Pendler zwischen grundverschiedenen Welten: Ein-, zweimal im Monat besucht er sein altes Dorf, schläft zwischen den Ziegen auf dem lehmgestampften Boden. Manchmal übernachtet er auf der Schlafcouch seines Onkels in Sesfontein. Die meiste Zeit aber verbringt er in Swakopmund. "Ein sehr spezieller Ort", sagt Titus.
Kaum etwas passt hier zusammen, nicht die kalten Brecher des Atlantiks und das verbrannte Wüstenhinterland, nicht die Legoarchitektur der Supermärkte und ihr Fachwerkimitat. Nicht wie Afrika, sondern eher wie ein Ostseebad kommt die Stadt daher, immer noch Relikt aus deutschen Kolonialzeiten, immer noch auf dem Weg Richtung Namibia.
Neben dem Leuchtturm an der Hafenpromenade sitzt eine Gruppe Himba-Frauen, die hier Schmuck verkauft, laut singend, trommelnd, klatschend, man kann sie bis ins Café Anton hören, wo es Schwarzwälder Kirschtorte gibt, Apfelstrudel und lauwarmen Gugelhupf. Das Prinzessin-Rupprecht-Heim ist jetzt ein Hotel, doch es hat sich nicht viel verändert seit der Zeit, als es ein Erholungsheim des Bayerischen Frauenvereins war. Und die "Antik-Shops" in der besenreinen Bismarck Street sind voll von Nazi-Devotionalien, rot-weiß gewürfelten Kuckucksuhren und Militaria.
Rodney Davies ist hier zu Hause, so wie schon sein Urgroßvater, der aus dem Münchner Norden kam, um, wie Rodney sagt, "sein Glück in Afrika zu suchen". Er hat es wohl gefunden, denn zur alten Heimat gibt es schon lange keine Brücken mehr. Und nie würde sich Rodney einen Deutschen nennen.
Auf seine linke Wade hat er die Umrisse Namibias tätowieren lassen. Mit "Bismarck-Kram" will er nichts zu tun haben. "Deutsch", sagt er, "das ist nur mein Stamm. So wie Titus Himba ist, bin ich eben Deutscher."
Vor ein paar Jahren haben sie sich in Swakopmund kennengelernt, Titus auf der Suche nach einem Job, Rodney auf der Suche nach einem Mitarbeiter, einem Guide für seine Trips in die Namibwüste, einem, der die meisten Sprachen im Nordwesten spricht, der weiß, wie man einen Geländewagen aus dem Treibsand zieht und der die Spur einer Hyäne von der eines Löwenweibchens unterscheiden kann. "Titus", sagt Rodney, "war perfekt."
"Man glaubt nicht, dass das alles Namibia ist"
Seitdem pendeln sie gemeinsam zwischen Swakopmund und dem Kaokoveld, ein-, zweimal im Monat, die Skelettküste 400 Kilometer Piste rauf und 400 runter, vorbei an gestrandeten Wracks und Robbenkolonien, zwischen Ostseegefühl und Kraal. "Man glaubt nicht, dass das alles Namibia ist", sagt Rodney, und Titus sagt: "Wie zwei verschiedene Sterne."
"Ein Ort, wo man zueinander kommt": die Wüstenlandschaft zwischen Damaraland und Kaokoveld. Dort lebt das Volk der Himba.
(Foto: mauritius images)So ungleich sind die beiden selbst: Rodney, ein Bär von einem Mann, dichter Vollbart, lautes Lachen, Lederhut, immer ein Messer griffbereit, immer auf der Suche nach einem kalten "Tafel Lager" und nie, niemals Gemüse. Titus, still, schlank und elegant, einer, der behutsam Wort für Wort sucht, beinahe schüchtern, stets korrekt. Und doch ist über die Jahre zwischen beiden eine Männerfreundschaft gewachsen. "Die Liebe zur Wüste", sagt Rodney, "die verbindet uns."
Meist schlagen sie mit ihren Gästen Zelte auf, weitab der Piste, oft im trockenen Flussbett des Hoanib, da wo das Himba-Land beginnt, unter Mopanebäumen und alten Tamarinden. Morgens pirschen sie durchs harte, gelbe Gras, scannen Stein für Stein die Geometrie der weiten Landschaft, Geröllhalden und Tafelberge, mal sehen, was sich so sehen lässt. Zebras, Oryxantilopen und Giraffen muss man nicht lange suchen in der Namib, wer aber Löwen oder Wüstenelefanten erleben will, braucht schon ein wenig Glück.
Und für ein Nashorn braucht es Rodney oder Titus. Deshalb kommen ihre Gäste hierher an den Hoanib. Fast alle Spitzmaulnashörner Afrikas leben hinter Zaun in Nationalparks, hier aber gibt es noch genau 38 in völliger Freiheit. "Frei wie Rodney", sagt Rodney, der sie alle kennt.
Abends sitzen sie am Feuer unter dem Kreuz des Südens, Rodney grillt Boerewors und Entrecôte, rührt Maisbrei und hat endlich ein halb gefrorenes "Tafel Lager"-Bier in der Hand. Vor zwei Jahren haben ihn Kunden nach Deutschland eingeladen: Freising, sagten sie, das ist doch deine alte Heimat. Ein Spaß sei das gewesen, sagt Rodney, Weißwurst-Grillen unter Protest, Freibäder und - unglaublich - das viele Grün. "Von Heimat aber", sagt er, "habe ich da nichts gespürt."
Und dass er erleichtert war, als er wieder im Flieger saß nach Windhuk. Titus sammelt schweigend das dreckige Geschirr ein, er weiß, dass man nicht nach Freising fliegen muss, um sich so fremd zu fühlen wie in einer anderen Galaxie. Übermorgen wird er in seinem alten Kraal vorbeischauen, die Brüder sehen mit der Unterkieferlücke, dann geht es wieder südwärts in die Legostadt.
Die Webervögel in den Akazien sind jetzt still geworden. Ein Generator surrt. Und im Feuer zerreißt die Hitze krachend einen gewaltigen Scheit aus Mopaneholz, Funken stieben auseinander und steigen himmelwärts, ein Sternenschwarm Richtung Orion, am Mars vorbei.
Anreise: Air Namibia fliegt von Frankfurt direkt nach Windhoek, Lufthansa und andere z. B. über Johannesburg (ca. 800 Euro). Man braucht kein Visum. Arrangement: Studiosus bietet eine 17-tägige Rundreise an, bei der auch ein Abstecher zu den Himba und ein Zeltcamp am Hoanib-Fluss Teil des Programms sind, ab 4245 Euro, www.studiosus.com
Beste Reisezeit: In unseren Sommermonaten ist im südlichen Afrika Winter. Die Temperaturen sind angenehm, die Nächte können aber vor allem in den Hochlagen und in der Wüste kalt werden. Die meisten Straßen Namibias sind Piste, Mietautos in der Regel Geländewagen. Linksverkehr!
Weitere Auskünfte: www.namibia-tourism.com
Die Recherchereise für diesen Beitrag wurde zum Teil unterstützt von Veranstaltern, Hotels, Fluglinien und/oder Tourismus-Agenturen.