
Es ist so erstaunlich wie beruhigend, dass gerade in diesen Tagen, in denen aus dem Weißen Haus mal wieder grausig rassistische Tweets versendet werden, in der amerikanischen Hauptstadt auch ganz andere Töne angeschlagen werden. In der ziemlich lebendigen Indie-Szene von Washington, D.C. spielen Bands wie Priests und Downtown Boys seit ein paar Jahren lauten, euphorischen und klugen Postpunk. Seit neuestem auch Gauche, eine Art "Supergroup" aus Mitgliedern der anderen Bands. Zu hören auf der tollen Platte "A People's History of Gauche" (Merge). Schnell und ansteckend sind die Gauche-Dreiminüter, mit drängelnden Beats und zackigen Gitarren, so leuchtend und tanzbar, wie Postpunk Ende der Siebziger schon einmal klang - und so politisch, wie es die Gegenwart verlangt. In bissigen Zeilen geht es um die Hamsterräder unserer Zeit, um Lohnschecks, Überwachung, die Ohnmacht von Frauen und People of Colour und das Gefühl ausweglos im System festzustecken. Kurzum: eine Sommerplatte über die Wut, über das Wegtanzen und Rausschreien ebendieser - und über die Schönheit des Dagegenhaltens.
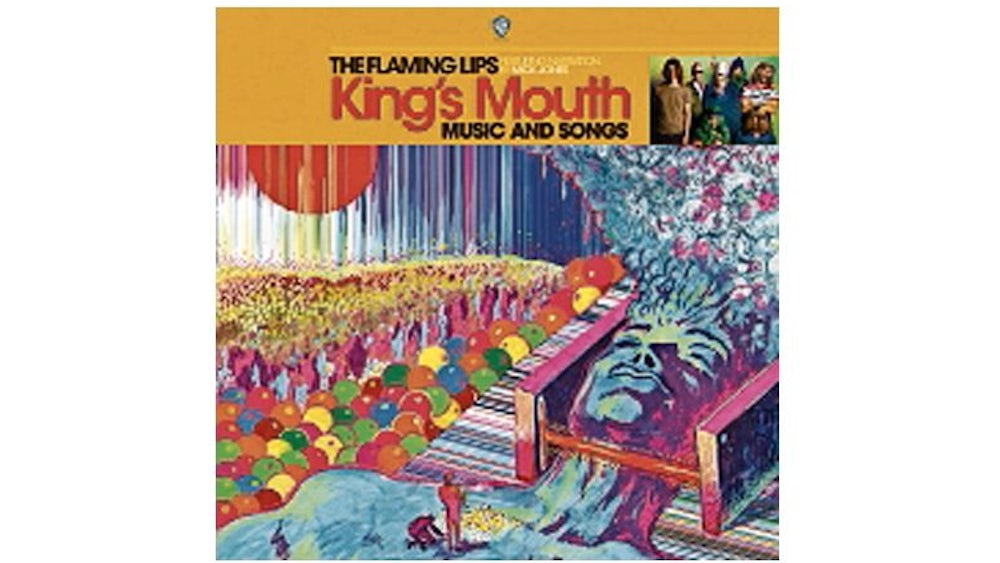
Passend dazu gibt es auch neue Musik übers Andersein: "King's Mouth" (Bella Union), das Album der Flaming Lips , gab es zum Record Store Day bereits kurz als limitierte Vinyl-Version, nun können sich endlich alle an ihrem neusten, fantastischen und bunt glitzerndem Psychedelic-Pop-Trip erfreuen. Denn eine so strahlend utopische und zugängliche Konzeptplatte ist Sänger Wayne Coyne seit "Yoshimi Battles The Pink Robots" (2002) nicht gelungen. Dabei hatte man nach den teils bizarren Experimenten und Abstraktionen der letzten Lips-Platten, schon Angst gehabt, die Band würde zur eigenen Parodie werden. Aber in Form einer versponnenen, von Clash-Gitarrist Mick Jones erzählten Heldengeschichte über ein königliches Riesenbaby, das sein Volk vor einer fremden Gefahr rettet, findet Coyne zurück zu seiner ursprünglichen Kunst, sich mit Hilfe der Fantasy-Welten seiner Figuren durch universelle Themen wie Beziehungen, Erinnerung und Tod zu wühlen. "Although I have died / I will always exist", legt er seinem König jubilierend in den Mund. Und meint sich selbst und uns alle.
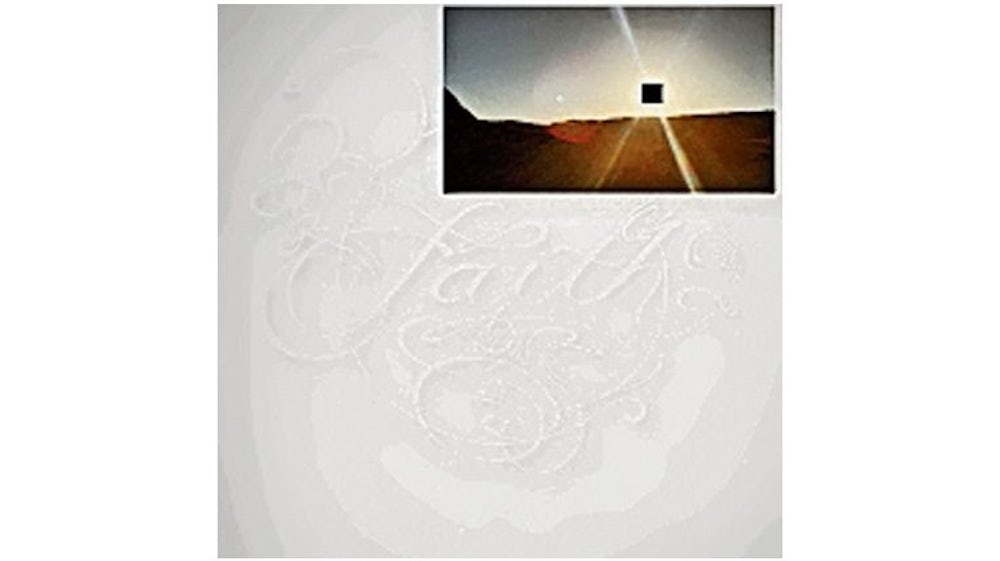
Während Wayne Coyne den Hofnarr gibt, ist Justin Vernon im Figurentheater der Popmusik eher der einsame Wanderer. Ein ziemlich langer, verschlungener Weg liegt hinter dem amerikanischen Songwriter und seinem Bandprojekt Bon Iver: vom Debüt "For Emma, Forever Ago" (2007) mit seinem emotionalen Exorzismus-Folk bis zu "22, A Million", jener Autotune-Experimentalplatte von 2016, die klang, als habe man metaphysische Folksongs mit kryptischen Texten durch einen kaputten Computer gejagt. Dass Vernon nun mit zwei Singles ein neues Album für Ende August angekündigt hat (Titel: "i, i"), dürfte alle freuen, die sich seitdem fragen, in welche Richtung der Weg noch führen kann. Im ersten Moment klingt die Ballade "Faith" (Jagjaguwar) nach einer Rückkehr zum Akustischen, dabei ist sie ein Amalgam aus allen Stärken des Vernon'schen Songwritings. Mit heller, unbearbeiteter Stimme singt er, begleitet von einer Akustikgitarre, über die komplizierte Verhandlungssache Vertrauen. So richtig intim wird der Song aber erst durch das zarte Fiepsen, Sirren und Pluckern der Synthesizer und Drum-Computer. Es ist nicht das aufregendste Bon-Iver-Stück. Trotzdem war nie klarer als hier, wo es hingeht mit ihm: Er will der Thom Yorke des Folksongs sein, will keine Geschichten erzählen, sondern in aller Vagheit von konkreten Gefühlen.

Neues gibt's auch von der norwegischen Avantgardemusikerin Jenny Hval. Sie macht seit einigen Jahren ja immer sonderbaren, aber nie langweiligen Konzept-Pop, in dem es zwischen elektronisch manipulierten Krachschichten um Geschlecht, Körper und Verlangen in Zeiten von Superkapitalismus und Clickbait-Kultur geht. Weswegen die neue Single "Ashes To Ashes" (Sacred Bones) mit den üppigen Synthie-Arpeggios, Uptempo-Beats und der eingängigen Refrain-Melodie auch erst mal überrascht. Es klingt nach irgendwas zwischen Dream-Pop und Eurodance. Aber nur, bis man auf die Texte hört: "I had a dream about this song that I had not written yet / Like I used to dream of fucking before I knew how." Die Songs sind also Trojanische Pferde für Hvals Sprache zwischen Traumdeutung, Erinnerungsarbeit und Körperpolitik. In der Welt der Gedanken, sagt sie uns, ist das Song-Schreiben so befriedigend wie das Sex-Haben, weil man es tut, bevor man weiß, wie es geht.