Das Einzige, was Flüchtlinge aus ihren Herkunftsländern immer mitbringen, wenn sie anderswo um Asyl ansuchen, ist ihre Legende. Eine Legende muss sein, doch sie muss nicht stimmen. Und manchmal stimmt auch der Name nicht.
In Abdulrazak Gurnahs Roman "By the Sea" aus dem Jahr 2001, der nun aus Nobelpreisgründen unter dem deutschen Titel "Ferne Gestade" neu aufgelegt wird, ist der Held ein alter Mann, ein Flüchtling aus Sansibar, der Mitte der 1990er-Jahre am Londoner Flughafen Gatwick um britisches Asyl ansucht - mit einem falschen Namen in einem falschen Pass, aber bar jeder Legende. Er sucht Zuflucht bei seiner ehemaligen Kolonialmacht, die Sansibar 1964 überstürzt in eine chaotische Freiheit entließ, will aber nichts von sich preisgeben. Er gibt vor, außer "Flüchtling" und "Asyl" kein Wort Englisch zu können.
Sein bockiges Schweigen verleiht ihm Stärke und Statur. Es erlaubt ihm, im Gefühl heimlicher Überlegenheit seine Selbstachtung zu wahren. Mit sarkastischer Höflichkeit, aber unerbittlich weist er die Hilfsangebote seiner Flüchtlingshelferin zurück. Sein Mantra, als er sich schließlich doch zum Englischsprechen bequemt, ist der berühmte Satz von Herman Melvilles unerklärlich störrischem Schreiber Bartleby: "Ich möchte lieber nicht." Dass seine englische Helferin das Zitat nicht einmal erkennt, erfüllt ihn mit stiller Genugtuung.
Anstelle einer Legende hat der widerborstige Asylwerber seinen kostbarsten Besitz mitgebracht: ein kleines Mahagonikästchen mit einem Rest Weihrauch aus Kambodscha, den er vor Jahrzehnten in Sansibar einem persischen Händler aus Bahrain abgekauft hat. Dieses köstlich duftende Ud-al-qamari steht für alles, was die uralte Kultur dieser ostafrikanischen Küstenregion seit jeher ausmachte.
Der Weihrauchduft ist ein Inbild des durch Handel verfeinerten Reichtums der multiethnischen und für jederlei Austausch von Waren, Ideen und Menschen durchlässigen Welt an den Gestaden des Indischen Ozeans, ehe diese durch wechselnde Kolonialmächte und die blutige Rassenpolitik postkolonialer Inseldespoten ruiniert wurde. Klar, dass dem Flüchtling das edle Kästchen sofort weggenommen wird, konfisziert vom Einwanderungsbeamten am Flughafen. Er beraubt damit den Flüchtling symbolisch dessen, was seine ureigene Individualität ausmacht: der historischen Würde seiner Herkunftswelt.
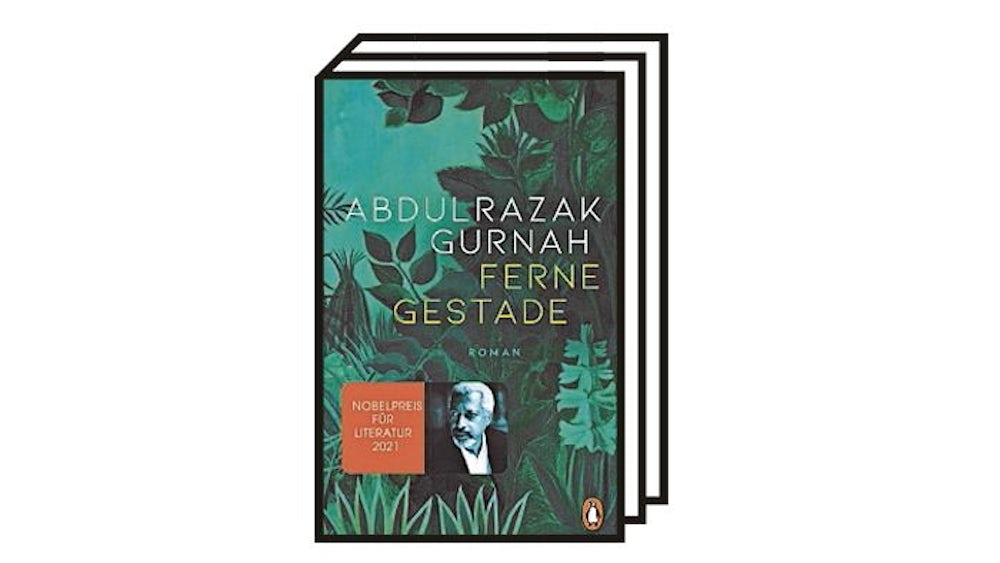
Es ist nicht so, dass der Mann, der sich Mr. Shaaban nennt, doch in Wahrheit Saleh Omar heißt, keine Legende hätte. Im Gegenteil. Was er über sein Leben in Sansibar zu erzählen hat, füllt die meisten der 400 Seiten dieses Romans. Allerdings will er sein Leben nur einem bestimmten Menschen erzählen - dem Literaturprofessor Latif Mahmud aus London, der ihm als Dolmetscher zugeteilt wurde.
Die zwei Protagonisten entstammen zutiefst verfeindeten Familien
Latif ist ein Landsmann, auch er stammt aus Sansibar: Vor dreißig Jahren ist er als Student über die damalige DDR nach England geflüchtet. Und wie es der unwahrscheinliche Zufall will, mit dem Abdulrazak Gurnah den narrativen Motor seines Romans anwirft, sind Latif und Saleh Omar nicht nur irgendwie verwandt, sondern auch durch eine erbitterte Familienfehde in der alten Heimat miteinander verstrickt.
Latif Mahmud ist der Sohn von Saleh Omars Todfeind, jenem Mann, dessen Identität er für seinen falschen Pass gestohlen hat. Wie es dazu kam, dass er sich für seine Flucht just den Namen seiner Nemesis angeeignet hat, davon handelt der Roman. Ausgebreitet wird ein unendlich verwickelter Rechtsstreit um ein Haus in Sansibar, der letztlich beide Familien ruiniert hat.
Sie haben einander wechselseitig mit jahrzehntelanger Niedertracht und kleinlicher, rachsüchtiger Gemeinheit zermürbt. Der Streit hat Latifs Familie auseinandergetrieben und Saleh Omars Leben zerstört. Er hat ihn seinen florierenden Möbel- und Antiquitätenhandel, all sein Vermögen, seine Frau und sein Kind gekostet, ihn für elf Jahre ins Gefängnis gebracht und letztlich aus dem Land getrieben und auf seine alten Tage noch zum Flüchtling und Asylsucher gemacht.
Die Erzählungen seiner Eltern halten nicht stand, Gewissheiten lösen sich auf
Und so stellt sich der Roman in der Gegenwartsebene dar: Zwei Migranten, die im ungastlichen England das einsame und freudlose "Halbleben von Fremden" ohne sicheren Platz in der Welt führen, rekapitulieren bei Strandspaziergängen am kalten Gestade eines ostenglischen Küstenstädtchens alteingefressene Hass-Erbschaften vom fernen Gestade der Insel Sansibar, die sie bis ins englische Exil weitergeschleppt haben, wo sie nun fortschwären. In langen Gesprächen suchen sie die Aussöhnung miteinander und mit ihrer Geschichte. Durch eine rückhaltlose Beichte möchte der schuldgequälte Saleh Omar von Latif späte Absolution erlangen. "Ich möchte, dass Sie mir vergeben", bittet er den Sohn seines Feindes.
Latif seinerseits kämpft damit, seine eigenen Kindheitserinnerungen und die giftigen Familienlegenden über Saleh Omars angebliche Ruchlosigkeit, Bosheit und Grausamkeit, die ihm von klein auf eingeträufelt wurden, in Einklang zu bringen mit der ganz anderen Version der Ereignisse, die er jetzt von seinem melancholischen Gesprächspartner zu hören bekommt. Das Bild, das sich Latif von seinen Eltern gemacht hat, kann dem nicht mehr standhalten, all seine alten Gewissheiten über sein Leben geraten ins Wanken.
Es ist nicht zuletzt das Gespräch über Bartleby, den Schreiber, das die beiden Kontrahenten einander näherbringt. Was den professionellen Leser Latif und den wilden Leser Saleh Omar miteinander verbindet, ist die Liebe zur Literatur, Erbe ihrer abendländisch indoktrinierten britischen Kolonialerziehung. Sie grübeln über Bartlebys Rätselhaftigkeit, fachsimpeln über "die teilnahmslose Kraft im Untergang dieses Mannes, die edle Sinnlosigkeit seines Lebens".
Gurnah verleiht einer literarisch bislang weitgehend stummen Weltregion eine Stimme
Sie fragen sich, ob "Bartlebys selbstkasteiender Rückzug auf sich selbst" nun heldenhaft und bewundernswert oder grausam und gefährlich zu nennen wäre. Immer deutlicher wird, dass Bartleby als Saleh Omars literarischer Avatar zu verstehen ist. Der Roman legt nahe, dass der Held sich selbst "als eine Art Bartleby sah, als jemanden mit geheimer und bedrückender Vergangenheit, der danach trachtete, sie durch Schweigen zu sühnen".
Der Nobelpreis wurde Abdulrazak Gurnah, dem aus Sansibar gebürtigen emeritierten Professor für Englische und Postkoloniale Literatur an der University of Kent, im Vorjahr nicht zuletzt deshalb verliehen, weil dieser Autor die Kolonialgeschichte strikt aus dem Blickwinkel der unterworfenen Afrikaner erzählt und der bisher literarisch weitgehend stummen Weltregion an der ostafrikanischen Küste eine ganze eigentümliche Stimme verleiht, leise, aber unbeirrbar in ihrer stillen Widersetzlichkeit.
Im Roman "Ferne Gestade" summieren sich Gurnahs Lebensthemen zur vielschichtigen Meistererzählung. Gezeichnet wird ein Wimmelbild vom Alltagsleben dieser geschäftigen Küstenregion mit ihren Kleinhändlern, Tagelöhnern, Trödlern und undurchsichtigen Kaufleuten aus dem Golf. Akkurat werden die Rangstufen und feinen ethnischen Unterschiede dieser muslimischen Männerwelt konturiert, mit ihren sorgsam austarierten Höflichkeits- und Respektformeln, ihren rigiden Clan-Strukturen und uralten Feindschaften, während die ins Haus verbannten Frauen eine weibliche Gegenwelt ohne Männer entfalten.
Eindrucksvoll, wie Gurnah seine ost-westlichen Lektüren in seine Romane einwebt
Gurnahs Erzählkosmos ist durchdrungen von der ethnischen Diversität dieser Region, in der alles durcheinanderwuselt - Kulturen, Traditionen, Stammesriten, Religionen, Archaik und Moderne, zählebiger lokaler Ahnen- und Geisterglaube und importierte Lebensarten und Denkweisen von weither, von den ferneren Gestaden des Indischen Ozeans.
Portugiesen, arabische Eroberer aus dem Golf, Deutsche und Briten haben hier ihre kolonialen Herrschaftsspuren hinterlassen; auch Inder, Perser, Khmer und Afrikaner von sonst woher, Handelsvölker allesamt, haben der Region ihren Stempel aufgeprägt - einer machtlosen Region ohne Kontrolle über ihr eigenes Schicksal.
Außerdem geht es Gurnah stets, wie auch in diesem Roman, um die migrantische Welterfahrung der Entfremdung, um die doppelte Entwurzelung und den Identitätsverlust von Migranten, die zwischen zweierlei Fremde pendeln, unzugehörig und unerwünscht hier wie dort. Nur in der Literatur, nicht in der politischen Realität, kann die Versöhnung unverwandter kultureller Welten gelingen. Eindrucksvoll, wie der hochbelesene Autor seine vielfältigen ost-westlichen Lektüren in seine Romane einwebt, sie durchsprenkelt mit Zitaten aus "Tausendundeiner Nacht" und dem Koran bis zu Shakespeare und den Klassikern der westlichen Moderne. So schreibt Abdulrazak Gurnah sein Werk in die Weltliteratur ein.

