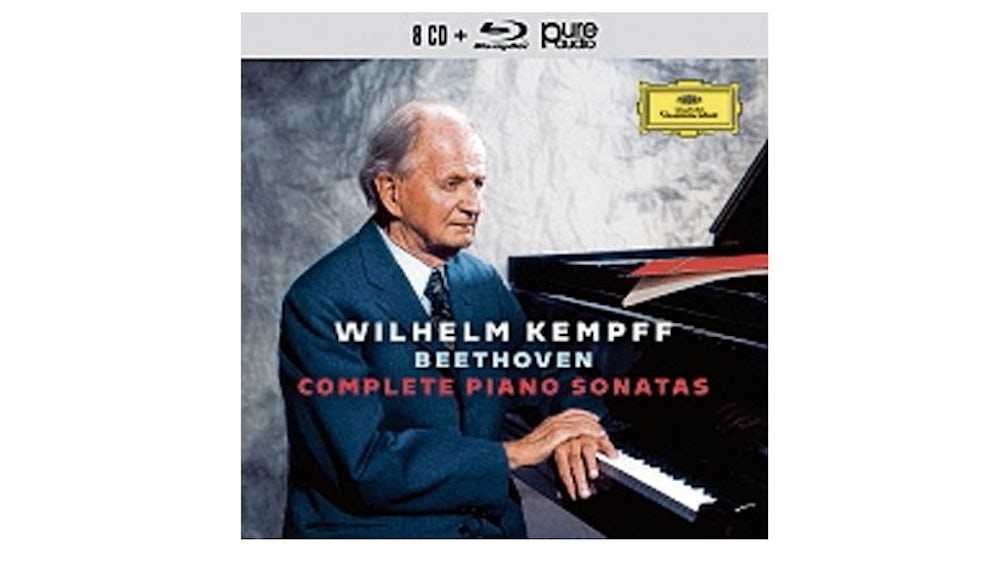Nun also: Die Ankunft. Die Reise mit "Destination Rachmaninov" (DG), die vergangenen Oktober mit dessen zweitem und viertem Klavierkonzerten auf dem Album "Departure" begann, ist vorerst zu einem fulminanten Ende gekommen. Auch hier zeichnet den Pianisten Daniil Trifonov grundsätzlich aus, dass er für die Art seines Musizierens, seine Botschaft, wenn man so will, gleichsam mit der eigenen Person einsteht. Das kennt man so eigentlich nur von den Alten, bei denen man das oft zu Unrecht als überkommenes Pathos abtat. Trifonov, dessen durch und durch musikalisch inspirierte Virtuosität immer wieder beeindruckt, überrascht gleich zu Beginn mit einer eigenen Transkription von Rachmaninows Chorsinfonie "Glocken". Die beginnt nun ganz oben auf der Tastatur, mit zimbelhellen Tastenglöckchen, weitet sich aber bald zum Großraumklang, der alle Höhen- und Farbregister erfordert. Ein Fingerfest für Trifonov, der über die Tasten herrscht wie kein Zweiter. Das Entscheidende: Rachmaninow klingt bei ihm selten sehnsüchtig, schon gar nicht historisch wie die Fotos auf den CD-Covers suggerieren, sondern höchst visionär, von damals aufs Heute gerichtet, also in eine höchst ungewisse und gleichwohl freudig erwartete Zukunft. Trifonov hat da den unmittelbarsten Zugang zum musikalischen Denken Rachmaninows, der in Europa eher als überzuckerter Anachronismus gehandelt und in den USA gerade deswegen so geliebt wird. Wenn man aber einmal versucht, Rachmaninow gar nicht zu verstehen, kann man mit Trifonov noch einmal von vorne anfangen. Mit großem Gewinn.
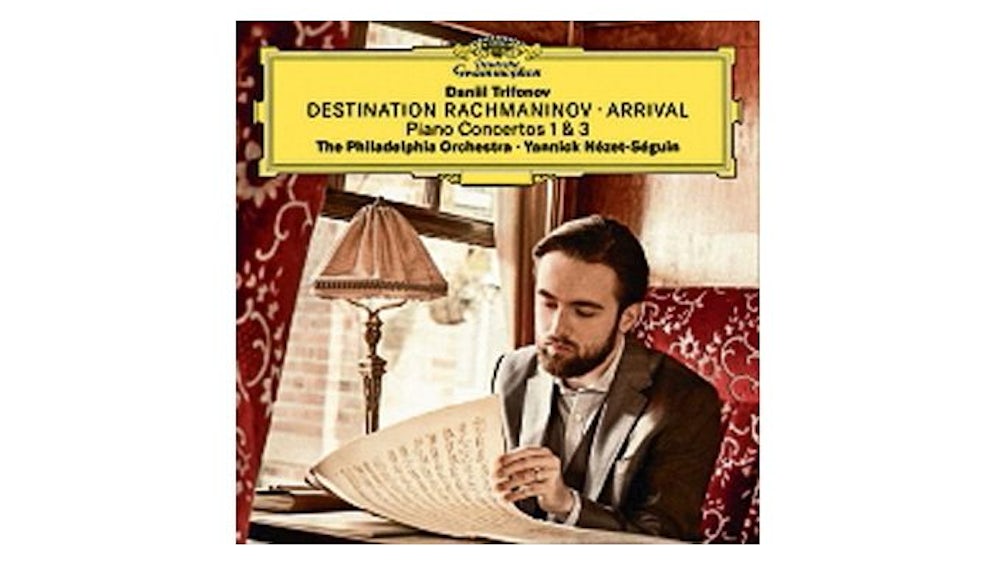
Der Pianist Andrew Tyson, 1986 in Durham geboren, überrascht auf seiner dritten CD-Veröffentlichung "Landscapes" (Alpha) durch sein außergewöhnlich poetisch-präzises Spiel, mit dem er nicht nur die Sonaten von Domenico Scarlatti auf den Punkt bringt, sondern auch die "Paisajes" von Federico Mompou, vor allem aber Franz Schuberts A-Dur-Sonate D 664. Tyson hat den Ernst und die Leichtigkeit, den Schubertschen Gedanken nachzuspinnen und gleichsam auch ihren Nachhall mit einzufangen. Man vergisst dabei die Schwere des modernen Flügels, mit dem Schuberts Klaviermusik andernorts oft erschlagen wird.
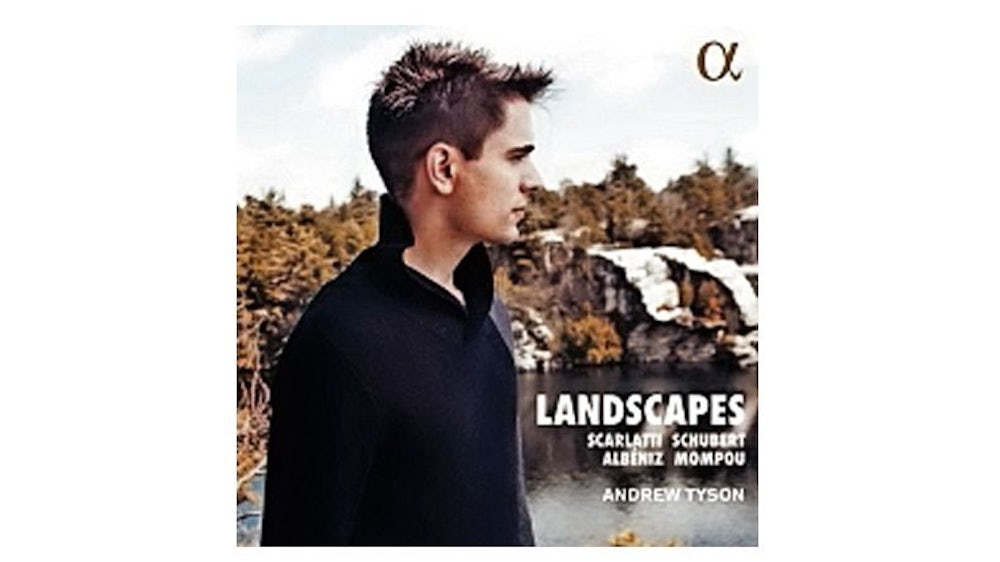
Der späten Schubertschen A-Dur-Sonate D 959 widmet sich Francesco Piemontesi mit Hingabe und Ausdauer, und er gehört zu den wenigen, die gleich den richtigen Schubert-Ton treffen (Pentatone). Beeindruckend allerdings ist die Annäherung an Schuberts letzte todessehnsüchtige B-Dur-Sonate, die man selten so uneitel und so umfassend nachgefühlt und nachgedacht hört. Nicht in der extremen Unbedingtheit wie bislang nur bei Trifonov und Afanassiev, aber doch mit gehörigem plausiblem Nachdruck.

Dieser Tage, da Beethoven wieder hoch im Kurs steht, erschienen gleich mehrere Sonaten-Editionen, etwa mit dem Pianisten Martino Tirimo (hänssler), der gleich alle Klavier-Solowerke Beethovens in Leipzig aufnahm, oder auch die historischen Aufnahmen von Wilhelm Kempff aus den Jahren 1964/65 (DG). Kempff ist darin zwar nicht mehr gar so zurückhaltend wie in seiner Gesamtaufnahme von 1951-56, wo der Attacca-Beginn von Opus 111 nur ein schwacher Huster ist, aber er bleibt sich doch darin treu, das Unbändige zu bändigen, den virtuosen Dompteur in der großen Beethoven-Arena zu geben. Nicht, um etwas umzubiegen oder zu vertuschen, sondern ganz im Gegenteil, um wichtige Details zu erhalten, die die Gesamterzählung stützen. Denn die gehen schnell verloren, wenn man die schnellen Läufe zu schlampig und lückenhaft abspult und dabei mitunter sogar in metrische Kalamitäten kommt. Man kann das gut anhand der Waldstein-Sonate studieren, wo Freunden der schlichten Provokation oft ein etwas zu grob gehämmertes Sforzato reicht. Oder beim markanten Einstieg zur Sonate opus 111: Kempf gestaltet hier durchaus eigenwillig, wenn auch ganz anders als Ives Nat, bei dem die schiere Verzweiflung spricht. Beim frühen Friedrich Gulda dagegen ist hier alle Wut noch musikalische Kraft, während er später, als müsse er sich der therapeutischen Befreiungsreligion der Zeit ergeben, einem eher aggressiven Ansatz schier freien Lauf lässt. Das ist hier aber allemal zivilisierter, als es Pianisten heute praktizieren, zum Konzept erheben, oder zur Masche: Beethoven eignet sich leider auch für pianistisches Posing. Dennoch kommt auch Kempff wegen seiner grundsätzlichen Zurückhaltung nicht an Gulda heran. Andere allerdings noch weniger.